Das Vermeiden der Leere
29. Juni, 2009Der Text in meinem letzter Eintrag beschreibt den buddhistischen Schlüsselbegriff dukkha zwar sehr schön, jedoch fehlt der Weg um uns aus unserem unglücklichen Zustand zu befreien. Die folgende, ebenfalls von Munish B. Schiekel übersetzte, hervorragende Arbeit von David R. Loy zeigt nicht nur diesen fehlenden Weg auf, sondern analysiert auch noch ausführlich die Ursache von dukkha aus psychotherapeutischer und buddhistischer Sicht.
Das Vermeiden der Leere: Der Mangel eines Selbst in Psychotherapie und Buddhismus.
David R. Loy - Chigasaki, Japan
Wenn Menschen aus nicht-medizinischen Gründen Drogen nehmen, dann nicht nur deswegen, um Schmerzen zu betäuben oder Vergnügen zu steigern oder verzerrte Wahrnehmungen hervorzurufen. Drogen sind eine Waffe gegen die Leere. In seinem Buch über Opium schrieb Jean Cocteau, dass jede menschliche Aktivität „in einem Expresszug stattfindet, der dem Tod entgegen rast“. Drogen zu nehmen, so sagt er, ist der Versuch aus diesem Zug heraus zukommen. Die machtvolle Illusion, die Drogen vermitteln, wird dann gesucht, wenn die alltäglicheren Illusionen versagen und insbesondere dann, wenn das Leben nicht mehr zu sein scheint als die Verbindung zwischen Geburt und Tod. [Luc Sante, The New York Review of Books, 16. Juli 1992]
Santes Argument bietet einen willkommenen Ausgleich gegen all das Moralisieren beim „Krieg den Drogen“. Es legt außerdem nahe, dass wenn wir das Drogenproblem (was zuallererst natürlich ein Alkoholproblem ist) ernsthaft angehen wollen, wir dann nicht nur betrachten sollten, wie wir versuchen zu fliehen, sondern auch warum wir vor der Leere davonlaufen.
Cocteau sieht als Kern unseres Problems den Tod. Dieses Verständnis ist in Übereinstimmung mit vielen der besten neueren Arbeiten der Psychotherapie. Existentialistische Psychologen, wie Ernest Becker und Irvin Yalom, glauben, dass unsere primäre Verdrängung nicht die sexuellen Wünsche betrifft, wie Freud das angenommen hatte, sondern die Einsicht, dass wir sterben werden (Becker, 1973, 1975; Yalom, 1980). Diese hier vorgelegte Arbeit möchte allerdings eine Interpretation des Buddhismus anbieten, die eine subtile, aber doch bedeutsame Unterscheidung zwischen der Angst vor dem Tod und der Furcht vor der Leere aufzeigt: unser größtes Problem ist nicht der Tod, denn diese Angst hält die gefürchtete Sache immer noch auf Distanz, indem sie sie in die Zukunft projiziert - unser größtes Problem ist der unmittelbarere und beängstigende (da ja ziemlich berechtigte) Verdacht, dass nämlich „Ich“ jetzt gar nicht wirklich bin.
Sakyamuni Buddha benutzte keine psychoanalytischen Begriffe, aber wenn wir jetzt versuchen, die buddhistische These von anatman, von der Ablehnung eines Selbst, zu verstehen, so können wir Nutzen ziehen aus dem Konzept der Verdrängung und der Rückkehr des Verdrängten in symbolischer Form. Wenn irgendetwas (ein mentaler Wunsch, gemäß Freud) dazu führt, dass ich mich unbehaglich fühle, und ich damit nicht bewusst umgehen will, dann kann ich wählen, dies zu ignorieren oder zu „vergessen“. Das erlaubt mir, mich auf etwas anderes zu konzentrieren, dennoch tendiert das Verdrängte dazu, in das Bewusstsein zurückzukehren. Was nicht bewusst in das Gewahrsein hereingelassen wird, bricht auf obsessiven Wegen hervor - in Form von Symptomen, die das Bewusstsein mit eben jenen Qualitäten beeinflussen, die es sich bemüht auszuschließen. Was könnte nun aus dieser Einsicht für anatman folgen?
Der Buddhismus führt in seiner Analyse das Selbst-Gefühl zurück auf Gruppen von unpersönlichen mentalen und physischen Phänomenen, deren Wechselwirkung die Illusion von Selbst-Bewusstsein kreiert, d.h. die Illusion, dass das Bewusstsein ein Attribut eines Selbst sei. Die Verdrängung des Todes, auf welche uns die existentialistische Psychologie hinweist, verwandelt den Ödipus-Komplex in das, was Norman Brown (1961) das Ödipus-Projekt nennt: der Versuch, sein eigener Vater, sein eigener Ursprung zu werden. Das Kind will den Tod besiegen, indem es versucht zum Schöpfer und Erhalter seines eigenen Lebens zu werden. Der Buddhismus stimmt dem zu, verschiebt aber die Betonung: das Ödipus-Projekt ist eher der Versuch des sich entwickelnden Selbst-Gefühls Autonomie zu erlangen, im Sinne von Descartes angeblich selbstständigem Bewusstsein. Es ist das Streben, die eigene Grundlosigkeit zu leugnen, indem man zu seinem eigenen Grund wird: zu jenem Grund (der sozial konditioniert und aufrechterhalten wird, aber dennoch illusorisch ist), den wir als das Sein einer unabhängigen Person kennen.
Wenn dem so ist, dann entstammt das Ödipus-Projekt unserer Intuition, dass das Selbst-Bewusstsein nicht etwas Selbst-Existentes (svabhava) ist, sondern eine mentale Konstruktion. Das Bewusstsein gleicht eher der Oberfläche des Meeres, abhängig von unbekannten Tiefen, und es kann als eine Manifestation eben dieser Tiefen jene nicht ergreifen. Das Problem entsteht dort, wo dieses konditionierte Bewusstsein sich selbst begründen will, d.h. sich selbst real machen will. Wenn das Selbst-Gefühl eine Konstruktion ist, dann kann es nur so versuchen sich zu real-isieren, indem es sich in irgendeiner Form in der Welt objektiviert. Das Ego-Selbst ist dieses unendliche Projekt, sich selbst zu objektivieren, wozu jedoch das Bewußtsein ebenso unfähig ist, wie eine Hand, die sich selbst ergreifen, oder ein Auge, das sich selbst sehen möchte.
Die Konsequenz dieses ständigen Versagens ist, dass das Selbst-Gefühl vom unvermeidbaren Schatten eines Mangel-Gefühls begleitet wird, dem es immer zu entkommen sucht. In der Sprache des Dekonstruktivismus ausgedrückt, ist der unausweichliche Pfad des Nichts in unserem Sein, des Todes in unserem Leben, ein Gefühl des Mangels. Die Wiederkehr des Verdrängten in der verzerrten Form eines Symptoms zeigt uns, wie wir dieses grundlegende und doch hoffnungslose Projekt verknüpfen können mit den symbolischen Ausdrucksweisen, durch welche wir versuchen uns in dieser Welt wirklich zu machen. Wir erfahren dieses tiefe Gefühl des Mangels als das Gefühl, dass „da irgendetwas mit mir nicht stimmt“, wenngleich sich natürlich dieses Gefühl und unsere Antwort darauf auf verschiedene Weisen manifestiert. In seinen „reineren“ Formen erscheint der Mangel als eine ontologische Schuld oder Angst, die fast unerträglich wird, weil sie am eigenen innersten Kern nagt. Aus diesem Grund möchte die ontologische Schuld eine Schuld für Etwas werden, weil wir dann wissen, wie wir dafür büßen können; und Angst strebt danach, sich als Angst vor Etwas zu objektivieren, weil wir dann Wege kennen, uns selbst vor den gefürchteten Dingen zu schützen.
Das Problem mit Objektivierungen ist, dass kein Objekt uns jemals befriedigen kann, wenn es nicht das ist, was wir wirklich wollen. Wenn wir nicht verstehen, was uns tatsächlich motiviert - weil das, was wir glauben uns zu wünschen, ja nur ein Symptom von etwas Anderem ist (gemäß dem Buddhismus, unser Verlangen real zu werden, was im wesentlichen eine spirituelle Sehnsucht ist) - dann enden wir zwanghaft. Daher sind das Leiden und die Verzweiflung des Neurotikers nicht das Ergebnis seiner Symptome, sondern ihre Ursachen; diese Symptome sind notwendig, um den Neurotiker vor Tragödien abzuschirmen, die wir Anderen besser unterdrücken können: Tod, Sinnlosigkeit, Grundlosigkeit. „Die Ironie der menschlichen Bedingtheit ist, dass es das tiefste Bedürfnis ist, frei zu sein von der Angst vor Tod und Auflösung; doch es ist das Leben selbst, das diese Angst in uns erweckt und so schrecken wir davor zurück, völlig lebendig zu sein“ (Becker, 1973, S. 181-182). [Für Becker führt die Konfrontation mit der Wahrheit der menschlichen Bedingtheit bei Abwesenheit psychologischer Schutzmechanismen zu einer mentalen Paralyse, entweder partiell (Neurose) oder schwerwiegend (Psychose). Verbergen wir diese Tatsache vor uns, so finden wir Sicherheit in einer Welt der Projektionen und Übertragungen (Becker, 1973, Kapitel 2-4 und passim).] Aus buddhistischer Sicht würde man sagen, wenn die Autonomie des Selbst-Bewusstseins eine Illusion ist, die ihr Schatten-Gefühl, dass „etwas mit mir nicht in Ordnung ist“, niemals ganz abwerfen kann, dann muss dieses Gefühl der Unzulänglichkeit irgendwie rationalisiert werden.
Solch eine Kritik verlagert unseren Fokus vom Schrecken vor der künftigen Auflösung hin zum Leiden einer jetzt erfahrenen Grundlosigkeit. In dieser Hinsicht symbolisieren sogar die Angst vor dem Tod und die Sehnsucht nach Unsterblichkeit etwas Anderes; sie werden zu Symptomen unserer vagen Ahnung, dass das Ego-Selbst nicht ein fester Kern des Bewusstseins ist, sondern eine mentale Konstruktion, die Achse eines Netzes, gesponnen, um die Leere zu verstecken. Mit Verrückten zusammen zu sein, d.h. mit Menschen, deren Konstruktionen stark beschädigt sind, ist uns auch deshalb unangenehm, weil sie uns an diese Tatsache erinnern.
Dieser Aufsatz wird für die soeben dargestellte Sichtweise auf zwei Arten argumentieren. Zunächst werden wir betrachten, was die Psychotherapie über Schuld, Angst und Projektion herausgefunden hat, um zu sehen, ob sie als verschiedene Symptome des gleichen Problems verstanden werden können, ein unterdrücktes Mangel-Gefühl, das dem Selbst-Gefühl immanent ist.
Dann werden wir der buddhistischen Interpretation von Mangel nachgehen, die mit einem großen Teil des psychotherapeutischen Verständnisses unserer Situation übereinstimmt, die aber einen Weg anbietet zur Auflösung unseres unglückliches Zustands. Der Buddhismus führt das menschliche Leiden (Duhkha) zurück auf Verlangen und Unwissenheit, und bezieht diese auf unseren Mangel eines Selbst. Das Selbst-Gefühl wird in wechselwirkende mentale und physische Prozesse dekonstruiert, deren Relativität zu post-strukturalistischen Schlussfolgerungen führen: das scheinbar einfache Selbst ist ein System wechselwirkender Kräfte. Die buddhistische Lösung dieses Problems ist einfach, obwohl keineswegs leicht: wenn es das Nichts ist, das wir so sehr fürchten, dann sollten wir zu diesem Nichts (no-thing) werden. Die Dualität zwischen Sein und Nicht-Sein kann aufgehoben werden, indem wir uns der Seite ergeben, die wir bislang abgelehnt haben. Wenn ich aufhöre meine Grundlosigkeit zu verleugnen, entdecke ich paradoxerweise, dass vollkommene Grundlosigkeit (Nicht-Sein) gleichbedeutend ist mit voller Grundhaftigkeit (Sein). Das enthüllt, dass es eigentlich niemals einen wirklichen Mangel gegeben hat, weil es niemals ein von der Welt abgetrenntes, selbst-existierendes Selbst gegeben hat. Das Problem des Verlangens ist dann gelöst, wenn die „schlechte Unendlichkeit“ des niemals zu befriedigenden Mangels sich verwandelt in eine „gute Unendlichkeit“, die nichts benötigt und daher ungehindert alles werden kann.
Schuld
Schuld ist für den modernen Menschen zu einem außerordentlichen Problem geworden und dies scheint sich noch zu verschlimmern. In Das Unbehagen in der Kultur (1929, bzw. Civilization and its Discontents, 1930/1989, S. 97) versteht Freud das zunehmende Schuldgefühl als den Preis, den wir für den Fortschritt in der menschlichen Kultur bezahlen, doch ist der Preis so hoch, dass Schuld nun zu dem „wichtigsten Problem in der Entwicklung der Kultur“ geworden ist. Norman O. Brown (1961) sieht die soziale Organisation als eine Struktur der geteilten Schuld: die Last ist so schwer, dass sie geteilt werden muss, um kollektiv gesühnt werden zu können. Otto Rank (1958, S. 194) zufolge ist der heutige Mensch neurotisch, weil er genauso wie der prämoderne Mensch an einem Bewusstsein der Sünde leidet, aber ohne an das religiöse Konzept der Sünde zu glauben, und also ohne eine Möglichkeit der Sühne bleibt. In den Ritualen des archaischen Menschen war das Gefühl der Schuldhaftigkeit ausgeglichen durch den Glauben, dass die Schuld zurückgezahlt werden könne; heute sind wir bedrückt durch die Einsicht, dass die Last der Schuld unbezahlbar ist. Selbst die Möglichkeit einer Sühne ist uns verwehrt, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dass unsere Schwierigkeiten von der Schuld herrühren. So häuft sich also unbewusste Schuld individuell wie auch kollektiv an, mit periodisch sich immer wieder katastrophal auswirkenden Konsequenzen. Ist das der Preis des Fortschritts, oder haben wir ein schlechtes Gewissen wegen all dem, was wir einander und der Erde antun? Oder sollte die Wurzel unserer Schuld unterschieden werden von den Gründen, die wir erfinden, um sie zu rationalisieren?
Freud führte die Schuld zurück auf die biologisch übertragene Erinnerung einer prähistorischen Urtat: Söhne, die sich zusammenschlossen, um ihren autokratischen Vater zu töten. Mit jeder Generation wird dieser Prozess aufs Neue im Ödipus-Komplex verinnerlicht; die gleichen instinktiven Wünsche wiederholen sich, können vom Über-Ich nicht verborgen werden und so entsteht Schuld. Das Kind hat Todeswünsche gegenüber den Eltern, ist aber auch von ihrer Liebe abhängig. Freud sah eine Parallele zwischen der libidinösen Entwicklung des Individuums und dem Sozialisierungs-Prozess der Kultur: beide benötigen die Verinnerlichung eines Über-Ichs, welches zu einem unvermeidlichen Konflikt mit instinktiven Bedürfnissen führt.
Es ist faszinierend zu betrachten, wie die Urtat von Freud als dem psychoanalytischen Vater und Jung, Adler, etc. als den rebellischen Söhnen nachgespielt wird. Ebenso beeindruckend ist es, dass Freud, der säkularisierte Jude, die Anfänge unserer „Ursünde“ in einer moralischen Gesetzesübertretung gegen den Vater lokalisiert, welcher zu Beginn der Geschichte stattfand und seitdem biologisch weitergegeben wird. Genau wie im Alten Testament sind wir nicht persönlich schuldig an der anfänglichen Gesetzesübertretung, erben aber dennoch die Konsequenzen. Gleichermaßen können wir nichts dafür, dass wir im Kindesalter Todeswünsche gegen unsere Eltern entwickeln, aber angenommen, diese Todeswünsche entstehen gegen die Menschen, die uns aufziehen, dann ist Schuld eine verständliche Reaktion. Beide Mythen erklären die Herkunft von Schuldgefühlen, indem sie uns moralische Gründe geben, die analog sind zu der Weise, wie wir uns das Funktionieren von Schuld im alltäglichen Leben vorstellen: wenn wir etwas Falsches tun (oder wollen), so fühlen wir uns deswegen schlecht. Der Mechanismus wird als der Gleiche angenommen. Die Ursünde mag urgeschichtlich sein, biologisch vererbt, vor-bewußt, und doch ist sie nur eine unterdrückte Version dessen, was immer dann geschieht, wenn wir gegen die natürliche Ordnung verstoßen. Im Sinne der Unterscheidung, die wir im nächsten Abschnitt zwischen neurotischer und ontologischer Schuld einführen, kann man sagen, dass für die Genesis und für Freud alle Schuld neurotisch ist, weil wir alle gesündigt haben.
Wenn jedoch das Ödipus-Projekt der Versuch des Selbst-Gefühls ist, sein eigener Grund zu werden und seine Abhängigkeit von anderen zu beenden, indem es autonom (d.h. selbst-bewusst) wird, dann braucht die entstehende Schuld nicht zurückverfolgt zu werden zu ambivalenten Wünschen. Denn diese Schuld hat ja eine ursprünglichere Wurzel in dem Gefühl des Mangels, welches zwangsläufig aus der unterdrückten Ahnung des Selbst-Bewusstseins folgt, dass es nicht selbst-existent ist. Solch grundlegende „Schuld“ ist nun nicht neurotisch, sondern ontologisch. Sie ist nicht die Konsequenz von etwas, das ich getan habe, sondern die Folge der Tatsache, dass Ich bin - wenn auch nur „irgendwie“. Ontologische Schuld entsteht durch den Widerspruch zwischen diesem gesellschaftlich konditionierten Gefühl, dass Ich bin und dem Verdacht, dass Ich nicht bin. Dieser Konflikt ist das Gefühl des Mangels und erzeugt ein Ich sollte sein… Die Tragödie ist, dass ich ins Sein „erwache“, nur um mit meinem Mangel an Sein konfrontiert zu werden. Schizophrene mögen sich sogar für ihre bloße Existenz schuldig fühlen, weil dieser Widerspruch in ihnen weniger stark unterdrückt ist.
Die Prähistorie der Genesis und Freuds Urtat mythologisieren diese Tatsache solcherart, dass jene Form des Bewusstseins keine natürliche Weise der Welterfahrung ist, sondern eine geschichtlich bedingte. Nach Erich Neumann (1973) schafft das volle Entstehen des Ich die ursprüngliche paradiesische Situation ab; dies „wird als Schuld erfahren, ja sogar als Urschuld, als Herabfallen“. Die Evolution des Homo Sapiens zum Selbst-Bewusstsein hat die menschliche Spezies vom Rest der Welt entfremdet, welche wir in dem Maße objektiviert von außen betrachteten, wie wir uns zu Subjekten wurden. Diese Ursünde wird von Generation zu Generation weitergereicht als die sprachlich konditionierte und sozial aufrechterhaltene Illusion, dass jeder von uns als ein von der Welt getrenntes Bewusstsein existiert. Doch wenn dies eine Konditionierung ist, so eröffnet sie die Möglichkeit einer Dekonditionierung oder Rekonditionierung.
Warum brauchen wir unser Schuldgefühl und akzeptieren Leiden, Krankheit und Tod als eine angemessene Bestrafung? Welche Rolle spielt diese Schuld bei der Bestimmung der Bedeutung unseres Lebens? Die beste Antwort kommt vielleicht nicht von Freud, sondern von einem Existentialisten: „Ursünde: ein neuer Sinn für Schmerz wurde erfunden“ (Nietzsche, 1956).
[“‘Sünde’ … stellt das größte Ereignis in der gesamten Geschichte der kranken Seele dar, den gefährlichsten Taschenspielertrick der religiösen Interpretation“ (Nietzsche, 1956, S. 277).]
Selbst die Empfindung von Übeltaten gibt uns ein Gefühl der Kontrolle über unser eigenes Schicksal, weil eine Erklärung für unser Gefühl des Mangels geliefert wird. „Das grundlegende Problem ist nicht Schuld, sondern die Unfähigkeit zu leben. Die Illusion von Schuld ist nötig für ein Tier, welches sich am Leben nicht erfreuen kann, um ein Leben der Freudlosigkeit zu organisieren“ (Brown, 1961, S. 270). In Zur Genealogie der Moral (bzw. The Genealogy of Morals) beobachtet Nietzsche, dass der Mensch bereitwillig leidet, wenn ihm eine Begründung für sein Leiden gegeben wird. Da nichts schmerzvoller zu ertragen ist, als purer Mangel, müssen wir ihn auf irgendein Objekt projizieren, denn nur so können wir ihn bewältigen. Wird dieses Objekt außerhalb gefunden, reagieren wir mit Ärger; wird dieser nach innen gerichtet, wandelt er sich zu Schuld (introjizierter Ärger, gemäß der Psychoanalyse). In „Einige Charaktertypen aus der psychoanalytischen Arbeit“ (bzw. „Some Character Types Met with in Psycho-analytic Work“) beschreibt Freud (1916) „Kriminelle aus einem Gefühl der Schuld“, deren Schuldgefühle so stark sind, dass das Begehen einer Missetat ihnen tatsächlich Erleichterung bringt - was Sinn macht, wenn das, wonach sie sich sehnen, irgendetwas Bestimmtes ist, wofür sie büßen können. „Schuld impliziert Verantwortung; und wie schmerzvoll auch immer die Schuld ist, sie mag der Hilflosigkeit vorzuziehen sein“ (Schmideberg, 1956, S. 476). Wir alle sind ja nur zu vertraut mit kollektiven Beispielen anderer Schuldzuweisungs-Systeme: Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus, usw. Wenn die soziale Organisation eine Struktur der geteilten Schuld ist, welch bessere Lösung gäbe es für das gemeinsame Gefühl des Mangels, als dieses auf einen gemeinschaftlichen Sündenbock zu projizieren? Dies ist das Ressentiment, welches Nietzsche (1968a; 1968b) in der Seele des modernen Menschen entdeckte:
Der Geist der Rache: dies, meine Freunde, war bis heute das Hauptanliegen der Menschheit; und wo es auch Leiden gab, da wurde immer Bestrafung angenommen. Und so weit wie der Mensch gedacht hat, hat er den Bazillus der Rache in die Dinge hineingebracht. Er hat sogar Gott damit infiziert, er hat generell der Existenz die Unschuld entzogen.
Dies enthüllt das Problem, zu dem das Postulieren einer Ursünde als dem letztlichen Grund für unser Leiden führt: anstatt uns zu helfen, unser Mangel-Gefühl zu beenden, verfestigt es unseren Mangel durch die Unterstützung mit einer Geschichte. Es ist auch dieses Postulieren der Ursünde, das die Institutionen, Religionen und dergleichen aufrechterhält, die behaupten, Kontrolle über die entsprechende Absolution zu haben.
Im Gegensatz dazu verfestigt der Buddhismus das Gefühl des Mangels nicht in eine Ursünde, obwohl unsere Probleme mit Anhaftung und Unwissenheit historisch konditioniert sind. Dies ist eine wichtige Art und Weise wie sich ein Nichtdualismus, wie etwa der Buddhismus, vom Theismus unterscheidet. Wenn wir an einen alles-liebenden, all-mächtigen Gott glauben, dann kann unser Leiden psychologisch nur gerechtfertigt werden, indem wir eine Urtat des Ungehorsams gegen Ihn postulieren. Sakyamuni Buddha erklärte, dass er nicht an der metaphysischen Frage des Ursprungs interessiert sei und betonte, dass er nur eine einzige Sache lehre: Duhkha und das Ende von Duhkha, unser Leiden jetzt und den Weg zur Beendigung dieses Leidens. Das bedeutet, dass der buddhistische Pfad nichts anderes ist, als ein Weg, um unser Gefühl des Mangels aufzulösen. Da es keine Ursünde und keine Vertreibung aus dem Paradies gegeben hat, stellt sich unsere Situation als paradox heraus: das aktuelle Problem ist unsere tief verdrängte Angst, dass unsere Grundlosigkeit / unser Nichts-Sein ein Problem ist. Wenn ich mit dem Versuch aufhöre, jenes Loch in meinem Inneren aufzufüllen, indem ich mich auf eine symbolische Art und Weise rechtfertige oder real-isiere, dann geschieht etwas mit dem Loch - und mit mir.
Dies kann leicht missverstanden werden, da das notwendige Loslassen für das Bewusstsein nicht direkt zugänglich ist. Das Ich kann sich von seinen eigenen Mangel nicht befreien, weil das Ich die andere Seite dieses Mangels ist. Wenn die ontologische Schuld „reiner“ erfahren wird - als das unobjektivierte Gefühl, dass „etwas mit mir nicht stimmt“ - dann scheint es keinen Weg zu geben damit umzugehen, also wird uns dieses Gefühl normalerweise auf diese oder jene besondere Art bewusst als die neurotische Schuld des „nicht gut genug zu sein“. Aus der Sicht des Buddhismus sollte die in solchen Situationen freigesetzte Schuld zurückverwandelt werden in die ontologische Schuld und diese Schuld muss ohne Ausflucht ertragen werden; die Methode dafür ist einfach nichtduale Achtsamkeit, welche in der Meditation kultiviert wird. Das Resultat ist, dass man sich zutiefst schuldig und völlig wertlos fühlt, nicht weil man irgendetwas getan hätte, sondern weil man einfach da ist. Durch das Loslassen der mentalen Verhaltensweisen, die meine Selbstwertschätzung aufrechterhalten, stehe ich allein und verletzlich da. Solche Schuld, die im Kern oder eher als der Kern des eigenen Wesens erfahren wird, kann nicht durch das Ich-Selbst aufgelöst werden; es gibt nichts, was man damit tun kann, außer sich darüber bewusst zu sein, dies zu ertragen und sich selbst ausbrennen zu lassen, so wie ein Feuer, das seinen Brennstoff selbst aufbraucht, welcher in diesem Falle das Selbst-Gefühl ist. Wenn wir die Fähigkeit kultivieren, damit zu leben so wie es ist, dann wird die ontologische Schuld, da sie nichts anderes findet, wofür sie schuldig sein könnte, das Selbst-Gefühl und damit auch die Schuld restlos aufzehren.
Dies kann leicht missverstanden werden, da das notwendige Loslassen für das Bewusstsein nicht direkt zugänglich ist. Das Ich kann sich von seinen eigenen Mangel nicht befreien, weil das Ich die andere Seite dieses Mangels ist. Wenn die ontologische Schuld „reiner“ erfahren wird - als das unobjektivierte Gefühl, dass „etwas mit mir nicht stimmt“ - dann scheint es keinen Weg zu geben damit umzugehen, und also wird uns dieses Gefühl normalerweise auf diese oder jene besondere Art bewusst als die neurotische Schuld des „nicht gut genug zu sein“. Aus der Sicht des Buddhismus sollte die in solchen Situationen freigesetzte Schuld zurückverwandelt werden in die ontologische Schuld und diese Schuld muss ohne Ausflucht ertragen werden; die Methode dafür ist einfach nichtduale Achtsamkeit, welche in der Meditation kultiviert wird. Das Resultat ist, dass man sich zutiefst schuldig und völlig wertlos fühlt, nicht weil man irgendetwas getan hätte, sondern weil man einfach da ist. Durch das Loslassen der mentalen Verhaltensweisen, die meine Selbstwertschätzung aufrechterhalten, stehe ich allein und verletzlich da. Solche Schuld, die im Kern oder eher als der Kern des eigenen Wesens erfahren wird, kann nicht durch das Ich-Selbst aufgelöst werden; es gibt nichts, was man damit tun kann, außer sich darüber bewusst zu sein, dies zu ertragen und sich selbst ausbrennen zu lassen, so wie ein Feuer, das seinen Brennstoff selbst aufbraucht, welcher in diesem Falle das Selbst-Gefühl ist. Wenn wir die Fähigkeit kultivieren, damit zu leben so wie es ist, dann wird die ontologische Schuld, da sie nichts anderes findet, wofür sie schuldig sein könnte, das Selbst-Gefühl und damit auch die Schuld restlos aufzehren.
Angst
Es ist wohl kein Zufall, dass alles, was bislang über Schuld gesagt wurde, nun erneut unter dem Begriff von Angst angeführt werden muss. Schuld scheint ein begrenzter Fall von Angst zu sein. Sogar die ontologische Schuld hat ein Objekt: das eigene Gefühl des Selbst, da es ja das Selbst ist, weswegen das Selbst sich schlecht fühlt. In der Angst jedoch erlangt der Mangel seine ursprüngliche Form, die formlos ist. Solch objektlose Angst zu kultivieren ist der direkteste Weg, um unsere eigene Formlosigkeit zu realisieren.
Freud erkannte nach und nach, dass die Angst ganz zentral für den Humanisierungsprozess ist. Zunächst verstand er die Angst als ein Nebenprodukt der Verdrängung, aber schnell korrigierte er sich. „Es war nicht die Verdrängung, welche die Angst hervorrief; die Angst war bereits zuvor da und erzeugte die Verdrängung.“ Dies macht dann eher das Ich als die Libido zum Sitz der Angst. Obwohl Freud betonte, dass sein Konzept des Unterbewusstseins von der Theorie der Verdrängung hergeleitet war, schaffte er es nie, die Frage zu seiner eigenen Zufriedenheit zu beantworten, warum es ursprünglich Verdrängung gibt. Bei neurotischen Phobien wird das Symptom konstruiert, um einen Ausbruch der Angst zu verhindern - das führt Neurose und Verdrängung zurück auf die Angst. Aber damit verschieben wir das Problem nur eine Stufe weiter nach hinten:
Wieder einmal sind wir uns im Unklaren über das Rätsel, mit dem wir schon so oft konfrontiert wurden: woher kommt die Neurose - was ist ihr letztlicher, ihr eigentümlicher raison d’etre? Nach zehn Jahren psychoanalytischer Arbeit befinden wir uns mit diesem Problem noch genauso im Dunkeln wie am Anfang (Freud, 1923/1989).
In der nächsten Generation war es Harry Stack Sullivan, der am meisten über Angst zu sagen hatte, und er erkannte eine ganz wesentliche Verbindung zwischen der Angst und der Bildung des Selbst. Angst entspringt ursprünglich aus der Befürchtung des Kindes vor der Missbilligung durch wichtige Personen in seiner Welt. So wie Freud sah Sullivan Angst als „kosmisch“ an, als etwas, das uns total ergreift, und das Selbst wird aus der Notwendigkeit des Kindes heraus gebildet, solche Angst erzeugenden Erfahrungen zu bewältigen, d.h. sich gegen die Angst zu verteidigen. Das Selbst „kommt ins Dasein als eine Dynamik um das Gefühl der Sicherheit aufrechtzuerhalten“. Dies trifft nicht nur auf das Verhalten, sondern auch auf das Bewusstsein selbst zu:
Das Selbst entwickelt sich dahin, das Gewahrsein zu kontrollieren und unser Bewusstsein darüber, was in unserer Situation vor sich geht, sehr weitgehend durch das Instrumentarium der Angst zu beschränken. Dies hat zur Folge, dass es zu einer Dissoziation des persönlichen Gewahrseins von solchen Tendenzen der Persönlichkeit kommt, die nicht in der gebilligten Struktur des Selbst enthalten sind oder in diese vereinnahmt wurden (Sullivan, Mai, 1977, S. 145-146).
Wir könnten um keine klarere Formulierung bitten: es ist nicht einfach nur so, dass irgendetwas verleugnet wird, denn gerade diese Verleugnung konstituiert ja das Selbst. Soviel zum Adel des kartesianischen Ich-Bewusstseins: das Selbst-Gefühl wird vom Ort der Rationalität zu einem Verhaltensmuster der Ausflüchte reduziert. Es ist kein Wunder, dass das Ich-Bewusstsein sich so unbehaglich anfühlt, da ja die Bewältigung von Unbehagen seine Rolle ist. Auch kein Wunder ist es daher, dass es so schwierig ist, zu erkennen, wer oder was wir sind, da ein solches Bewusstsein kein Sein, sondern nur eine Funktion ist. Dies macht aus dem Selbst-Gefühl einen doppelten Mangel: ein grundloses Gewahrsein mit der Aufgabe, Angst zu verdrängen.
Ebenso wie die ontologische Schuld zu einem spezifischeren Fehler werden „will“, damit ich mit dem fertigwerden kann, was an mir nicht stimmt, so will auch die Angst zu einer Furcht werden. Freud unterschied zwischen der Angst (bei der es keine Bedrohung durch ein Objekt gibt) und Furcht (bei der eine solche vorhanden ist), aber Psychoanalytiker nach ihm empfanden diese Unterscheidung als in der Praxis schwierig beizubehalten. Rollo May zufolge „ist Angst die ursprüngliche und grundlegende Reaktion … und Furcht ist der Ausdruck der gleichen Fähigkeit in ihrer spezifischen, objektivierten Form“. Angst „ist objektlos, weil sie an der Basis jener psychologischen Struktur angreift, bei welcher die Wahrnehmung des eigenen Selbst als getrennt von der Welt der Objekte entsteht“ (1977, S. 198, 182). Nach meiner buddhistischen Interpretation begleitet solch reine Angst die Intuition des Ich-Selbst von seiner eigenen Unwirklichkeit; wie beruhigend ist es also, diese Angst nach außen zu projizieren als Drohung durch ein externes Objekt. Wenn das Selbst durch die Verleugnung der Angst konstituiert wird, wie Sullivan zu sagen scheint, dann wird die Objektivierung der Angst in Furcht auch das Selbst-Gefühl in dasjenige subjektivieren, das mit der Furcht umgeht, - und in dasjenige, was vor der Bedrohung beschützt werden muss.
Wenn das so ist, dann impliziert die Beendigung der Angst (falls das möglich ist) auch die Beendigung des Selbst-Gefühls als etwas Autonomes und Selbst-Begründetes. Freud sagt, das, was das Ich in der Angst fürchtet, „ist dem Wesen nach eine Vernichtung oder Auslöschung“. Rollo May fügt hinzu, dass bei der Angst „die Sicherheitsgrundlage des Individuums bedroht wird, und da es unter der Bedingung dieser Sicherheitsgrundlage für das Individuum erst möglich war, sich als ein Selbst in Bezug zu Objekten zu erfahren, bricht der Unterschied zwischen Subjekt und Objekt ebenfalls zusammen“ (May, 1977, S. 183). Kein Buddhist könnte es besser ausdrücken. Solch ein Zusammenbruch ist für die Psychoanalyse eine Definition der Psychose, für den Buddhismus kann er die Erleuchtung beschreiben:
Wo es ein Objekt gibt, da gibt es auch ein Subjekt, doch nicht dort, wo es kein Objekt gibt. Aus der Abwesenheit eines Objekts resultiert auch die Abwesenheit eines Subjekts, und nicht nur die Abwesenheit des Ergreifens. Eben auf solche Weise entsteht jene Wahrnehmung, die ungeteilt, objektlos, unterschiedslos und überweltlich ist. Die Neigungen, Objekt und Subjekt als getrennte und reale Einheiten zu sehen, sind aufgegeben und das Denken wird in der wahren Natur des eigenen Denkens gegründet (Vasubandhu, 1964).
So stellt sich die Frage, ob die Subjekt-Objekt Unterscheidung auf verschiedene Weisen zusammenbrechen kann: warum kann der Mystiker in demselben Meer schwimmen, in welchem der Psychotiker ertrinkt.
Zusammengefasst impliziert die buddhistische Kritik des Ich-Selbst, dass Angst für das Ich essentiell ist, weil sie die Antwort des Ich auf seine eigene Grundlosigkeit ist, etwas das unmittelbarer und bedrohlicher erscheint als die Angst vor dem Tod irgendwann in der Zukunft. Dieses Thema ist auch in der existentialistischen Philosophie bekannt, doch ungewohnt in der Psychoanalyse. In Existential Psychotherapy diskutiert Irvin Yalom das, was er die „Ur-Angst“ der Grundlosigkeit nennt, doch er folgert, dass anders als die Todes-Angst (welcher er fast die Hälfte seines Buches widmet), die Grundlosigkeits-Angst in unserer Alltagserfahrung nicht offensichtlich ist (Yalom, 1980, S. 221-222).
[Existential Psychotherapy 221-222. Dennoch zitiert Yalom eine gewisse Evidenz für die Grundlosigkeits-Angst. Beispielsweise haben Adah Maurer und Max Stern unabhängig voneinander Forschungen über die nächtlichen Schrecken sehr junger Kinder durchgeführt. Stern schloss, dass das Kind vor dem Nichts in Panik verfällt; Maurer folgert, die erste Aufgabe des Kindes sei es, zwischen Selbst (Sein) und Umgebung (Nichtsein) zu unterscheiden, und während eines nächtlichen Schreckens könnte das Kind ein „Gewahrwerden des Nichtseins“ erfahren (S.89).]
Ist solche Angst so schwer zu erkennen, weil sie so selten ist - so begrenzt vielleicht, wie abstrakte Philosophen sagen - oder weil sie so gut verdrängt ist?
Otto Rank unterschied Angst in einem einflussreichen Aufsatz mit dem Titel „Lebens-Furcht und Todes-Furcht“ („Life Fear and Death Fear“) in zwei gegensätzliche, aber komplementäre Arten der Furcht. Die Lebens-Furcht ist die Angst angesichts des Heraustretens aus der Natur und der Individuation, wodurch wir die Verbindung mit dem größeren Ganzen verlieren. Die Todes-Furcht ist die Angst angesichts der Vernichtung, des Verlustes der Individualität und der Auflösung zurück in das Ganze. „Zwischen diesen beiden Möglichkeiten der Furcht wird das Individuum sein ganzes Leben lang hin und her geworfen“ (Rank, in Yalom, 1980, S. 141-142). In Existential Psychotherapy entwickelt Yalom dies weiter zu seinem eigenen dualen Paradigma der Todesverleugnung durch Individuation oder Vereinigung. Die psychologische Verteidigungshaltung der Besonderheit versucht, anders und besser zu werden als alle anderen und sich auf diese Art ein besseres Schicksal zu verdienen. Die Verteidigungshaltung der Vereinigung versteckt sich in der Gruppe, was die Erwartung einschließt, dass andere sich um einen kümmern. Yalom verwendet diese Verteidigungshaltungen gegen den Tod, um das Verhalten vieler seiner Klienten zu erklären, ungeachtet der Tatsache, dass viele von ihnen wenig bis gar keine Todes-Angst zeigen.
Meiner Meinung nach braucht Yaloms Paradigma nicht auf jene Anwendungsfälle beschränkt zu werden, die Yalom dafür findet, denn die Haltungen der Besonderheit und der Vereinigung können ja bei der Verteidigung gegen ein Gefühl des ontologischen Mangels noch erfolgreicher sein. Wenn ich durch eine uneingestandene Intuition meiner Grundlosigkeit angetrieben werde, dann kann ich versuchen dies dadurch zu kompensieren, dass ich jemand besonderes und aus der Menge herausragendes werde, in der Hoffnung, durch die Anerkennung der Menge real zu werden. Umgekehrt kann ich auch versuchen, mein Gefühl des Mangels durch die Vereinigung mit anderen zu lösen, um mich nicht von ihnen zu unterscheiden: „ich bin in Ordnung; ich bin genauso wie alle anderen“. Im ersten Fall kompensiere ich durch das Bestreben, realer als andere zu werden; im zweiten Fall beruhige ich mich selbst, indem ich nicht weniger real werde, als die anderen zu sein scheinen.
Bis vor kurzem lag die Betonung auf einer mehr gemeinschaftlichen Version des letzteren. Gesellschaft kann sehr wohl eine Struktur der geteilten Schuld sein, wie Brown sagt, aber es ist doch viel offensichtlicher eine Struktur der geteilten Angst. Heute ist unser Problem mit der Angst aus zumindest zwei Gründen größer: eine individualistischere Gesellschaft produziert Menschen mit einem stärkeren Selbst-Gefühl, und dadurch bedingt mit stärkerer Angst, und diese Gesellschaft stellt weniger effektive Wege bereit, mit dieser Angst fertig zu werden. Religion ist der traditionelle Trost, weil sie mir versichert, dass meine Angst zur Ruhe kommt, mein Mangel gefüllt wird, und meine Grundlosigkeit in Gott oder Nirvana gegründet werden wird. Wenn dies unser tiefstes Bedürfnis ist, dann wird der Tod Gottes nur die Suche nach einem Äquivalent zur Folge haben. Die Individuelleren können versuchen ihre eigenen Egos zu vergöttern, aber es ist schwierig, zu seiner eigenen Sonne zu werden. Die meisten Menschen benötigen eine kollektivere, eine objektiviertere Gottheit. Hierin liegt viel von der Anziehungskraft des Anspruchs von Nationalismus und Sozialismus, den „Willen der Menschen“ auszudrücken. „Wenn Modernisierung als die sich ausbreitende Bedingung der Heimatlosigkeit beschrieben werden kann, dann kann Sozialismus als das Versprechen einer neuen Heimat verstanden werden“ (Berger, Berger & Kellner, 1973).
Hier liegt auch der Schlüssel zum Verständnis vieler Horrorgeschehnisse des zwanzigsten Jahrhunderts.
Der Totalitarismus ist ein kulturelles neurotisches Symptom der Notwendigkeit von Gemeinschaft - ein Symptom in der Hinsicht, dass er als ein Mittel zur Reduktion der Angst ergriffen wird, wie sie aus dem Gefühl der Machtlosigkeit und Hilflosigkeit von isolierten, entfremdeten Individuen erwächst, produziert von einer Gesellschaft, in der ein vollständiger Individualismus das dominante Ziel war. Totalitarismus ist die Substitution des Kollektivismus für die Gemeinschaft, wie Tillich das aufgezeigt hat (May, 1977, S. 212).
[Ohne ein solches psychoanalytisches Verständnis sind soziologische Erklärungen, wie Hannah Arendts „Die Banalität des Bösen“ unvollständig. (Siehe ihr Eichmann in Jerusalem: Ein Bericht über die Banalität des Bösen (New York: Viking, 1964), S.276 und passim.)]
In dem Abschnitt, dem dieses Zitat entnommen wurde, untersucht May die Dinge nicht tiefer, als bis hin zu der Notwendigkeit von Gemeinschaft; er betrachtet nicht, wofür diese Notwendigkeit stehen könnte. Das ist kein unwichtiges Thema im Zusammenhang mit dem sich rapide entwickelnden „globalen Dorf“, weil es doch bedeutet, dass es keine Rückkehr zu den kleinen Städten gibt, die noch bis vor ein paar Generationen die meisten von uns unterstützt haben. Nostalgie mag diese Gemeinschaften mythologisieren, tatsächlich aber lieferten sie die Sicherheit einer gemeinsamen Weltsicht und die Hoffnung auf Erlösung in der einen oder anderen symbolischen Form. Ohne diese Möglichkeit stellt sich die Frage, ob es eine andere Alternative zum Massenkollektivismus gibt, eine andere Art der Gemeinschaft, in der Individuen fähig sind, mehr persönliche Verantwortung für den Umgang mit erhöhter Angst und das Lösen ihres eigenen ontologischen Mangels zu übernehmen.
Dies bringt uns zurück zu der Möglichkeit, Angst zu beenden. Erneut lässt sich vieles von dem, was zuvor über die Beendigung der Schuld gesagt wurde, auch hier anführen, gleichsam übertragen von einem geringer wichtigen Thema zu einem bedeutenderen. Aber noch bemerkenswerter im Zusammenhang mit Angst ist die fast einmütige Übereinstimmung zwischen Existentialisten und Psychoanalytikern, dass Angst nicht beseitigt, sondern nur reduziert und am rechten Platz gehalten werden kann. Viele Psychologen bezweifeln generell, dass Angst beseitigt werden sollte, da sie diese als einen Antrieb zu einem erhöhten Gewahrseins sehen, oder doch als dessen notwendiges Nebenprodukt. Liddell merkt an, dass „Angst intellektuelle Aktivität wie ein Schatten begleitet“ (zit. nach May, 1977, S. 46).
Für eine andere Sichtweise müssen wir uns erneut der Religion zuwenden, was uns mit der Aufgabe konfrontiert, die Transformation zu entmythologisieren und von der Tröstung zu unterscheiden, und damit zwischen Möglichkeit und Wunschdenken zu unterscheiden. Für die Rolle der Angst im religiösen Leben kann ich keine bessere Darstellung finden als das kurze Kapitel, welches Kierkegaards Das Konzept der Angst abschließt. Auf wenigen unvergesslichen Seiten skizziert Kierkegaard das Paradox, dass, falls es ein Ende der Angst geben sollte, dieses nur durch die Angst gefunden werden kann. Richtig verstanden und erfahren (jemand der diese Angst missversteht ist verloren, sagt er), ist Angst eine Schule, die alles Endliche und Belanglose in uns entwurzelt und uns erst dann überall dorthin bringt, wo wir hin wollen. Ebenso wie der Frage der Schuld ist auch hier der Pfad der Integration ein Gewahrsein, welches die Angst nicht flieht, sondern sie erträgt, um die Teile der Psyche zu heilen, die sich abgetrennt haben und jetzt zurückkehren, um uns in projizierter, symbolischer Form zu quälen. Wenn es, um Schuld zu integrieren, der Weg ist, vollkommen schuldig zu sein, dann ist der Weg, um Angst zu integrieren, vollkommen zu Angst zu werden: formlose, unprojizierte Angst an all diesen „begrenzten Zielen“ nagen zu lassen, mit denen ich versucht habe mich selbst abzusichern; so dass durch das Verschlingen dieser Anhaftungen die Angst mich ebenfalls verschlingt und wie ein Parasit, welcher seinen Wirt umbringt, sich selbst verzehrt (siehe Kierkegaard, 1957, S. 155-162).
Wenn wir lernen, Angst zu erfahren, so lernen wir das Endgültige, sagt Kierkegaard. Die Schule der Angst ist der Weg zu wahrer Freiheit; jener Freiheit, die uns verbleibt, nachdem wir von all den tröstlichen Verstecken befreit wurden, in die wir uns automatisch zurückziehen, wann immer wir uns unsicher fühlen. Nur solche Angst ist „absolut erzieherisch, weil sie alle begrenzten Ziele konsumiert und all ihre Täuschungen entdeckt.“ Der Lehrplan dieser Schule ist die Möglichkeit, „die schwerste aller Kategorien.“ Ganz gleich welche Tragödien uns aktuell zustoßen, sie sind doch immer weit leichter als das, was geschehen könnte. Wenn ein Mensch „die Schule der Möglichkeiten abschließt, … dann versteht er besser, als ein Kind sein ABC kennt, dass er vom Leben nichts verlangen kann und dass das Schreckliche, die Verdammnis und Auslöschung Tür an Tür mit jedem Menschen leben.“ Es ist eine Übung der Achtsamkeit: alle psychischen Sicherheiten auszugraben, mit denen wir uns umgeben und die wir dann „vergessen“ haben, bis wir uns selbst in einer sicheren aber eingeschränkten kleinen Welt wiederfanden. Das Bewusstsein darüber, was uns in jedem Augenblick zustoßen könnte, dekonstruiert diesen komfortablen Kokon durch die ständige Erinnerung unserer Sterblichkeit; psychotherapeutisch gesprochen, macht dies unsere unbewussten Kraftverbindungen oder Unterstützungen zunichte. „Er, der er in Möglichkeiten versank … sank absolut, doch tauchte dann aus der Tiefe des Abgrundes wieder auf, leichter als all die schwierigen und schrecklichen Dinge des Lebens.“ Solch ein Mensch fürchtet das Schicksal nicht mehr, „weil die Angst in ihm das Schicksal bereits geformt hat und ihm absolut alles genommen hat, was das Schicksal ihm nur nehmen könnte“. Diese spirituelle Disziplin steht in deutlichem Gegensatz zum Gefühl des göttlichen Schutzes, der üblicherweise als ein weltlicher Vorteil des religiösen Glaubens angenommen wird. Kierkegaard ist keineswegs weniger am Glauben interessiert, aber dieser ist für ihn nicht so billig erhältlich. Authentischer Glauben ist keine Zuflucht vor der Angst, sondern die Frucht der Angst.
Wenn das Ego-Selbst eine mentale Konstruktion ist, deren Funktion es ist, ein Gefühl der Sicherheit aufrechtzuerhalten (wie Sullivan es versteht), dann sollte solch eine Übung der Dekonstuktion der Sicherheit das Selbst-Gefühl auflösen. Normalerweise ist ein großer Teil unserer geistigen Aktivität von dem Bedürfnis bestimmt, beruhigende Verstecke zu finden, in die wir fliehen können, wenn unser Selbstbewusstsein bedroht ist. Ein triviales Beispiel: wenn ich ein Schachspiel gegen einen Gegner mit einer viel geringeren Einstufung verliere, so kompensiere ich automatisch: die offiziellen Einstufungen zeigen ja, dass ich in Wirklichkeit der bessere Spieler bin. Durch Wiederholung verfestigt bildet das Netz solcher Automatismen meinen Charakter und damit meine Unfreiheit: all die Verhaltensweisen, mittels derer ich gewohnheitsmäßig vor einer Begegnung mit der Welt davonlaufe. Sowohl im Buddhismus wie auch bei Kierkegaard muss ich diese gedanklichen Stützen aufgeben, und das bedeutet zu leiden. Ohne diese Verteidigung des Selbstbewusstseins sterbe ich Tausende kleiner Ego-Tode, oder in der Zen-Metapher, ich laufe auf den Schneiden Tausender Schwerter. Nach Kierkegaard sind solche gedanklichen Stützen die Endlichkeiten, welche entwurzelt werden müssen, um das Unendliche freizulegen, das unser wahrer Grund ist.
Projektion
Unsere Diskussionen über Schuld und Angst müssen durch einige Hinweise auf ihre Objektivierungen ergänzt werden: Projektion und Übertragung. Die scheinbar objektive Welt wird ja unbewusst strukturiert durch die Art und Weise, wie wir uns selbst in dieser Welt zu sichern suchen. Wir treffen erneut auf den bedauerlichen Widerspruch, dass gerade dieser Versuch mich selbst in der Welt zu begründen, mich von der Welt trennt.
In Das Ich und das Es stellt Freud fest, dass das dynamisch unbewusst Unterdrückte nicht fähig ist, auf normalem Wege bewusst zu werden, und er vermutet, dass „alles, was von innen heraus bewusst werden will, versuchen muss, sich selbst in äußere Wahrnehmungen zu verwandeln“ (Freud, 1923/1989, S. 12 - 13). Dieses Verständnis wird heute als selbstverständlich angenommen, und obwohl die Art wie Freud dies formuliert auch unsere gewohnte Trennung zwischen Subjekt und Objekts als selbstverständlich hinnimmt, stellen doch die Phänomene auf die er sich bezieht - Projektion und Übertragung - diese Sicht in Frage. Solche Formulierungen setzen voraus, dass der Ort des Unbewussten irgendein Platz in mir ist, und dass die objektive Welt das ist, was sie zu sein scheint, nämlich etwas von mir Getrenntes. Wie die meisten Menschen das immer tun, und wie vielleicht alle Menschen das zu den meisten Zeiten tun, so nimmt auch Freud die Objektivität der Welt als selbstverständlich an - und doch ist das eine gefährliche Annahme angesichts Kants kopernikanischer Revolution, den neuesten Entdeckungen der Quantenphysik und der Kognitiven Psychologie. Es ist eben sehr schwierig, sich dieser Annahme bewusst zu werden, wenn wir die Welt auf eine Weise konstituieren, welche die Tatsache verbirgt, dass wir sie konstituiert haben:
Vielleicht ist die allerwirksamste Verteidigung [gegen die Todesangst] einfach die Wirklichkeit, so wie sie erfahren wird - das heißt, die Erscheinung der Dinge … Erscheinungen treten in den Dienst der Verleugnung: wir konstituieren die Welt auf solche Weise, dass sie unabhängig von unserer Konstitutierung erscheint. Die Welt als eine empirische Welt zu konstituieren, bedeutet sie als etwas von uns selbst Unabhängiges zu konstituieren (Yalom, 1980, S. 222).
[Eine ähnliche Einsicht - dass das Ich nicht nur verdrängt, sondern auch die Tatsache seines Verdrängens verdrängt - war ein Wendepunkt in Freuds Entwicklung, der seine Untersuchungen vom Wesen des Verdrängten hinführte zur Untersuchung des Verdrängungsprozesses.]
Warum ist dies eine solch wirksame Verteidigung gegen die Angst? Warum vergessen wir, dass wir die Welt (die ja eine soziale Konstruktion ist und die wir lernen so wahrzunehmen wie die Anderen) konstituiert haben? Yalom bringt dies mit einer verdrängten Angst der Grundlosigkeit in Verbindung, die uns versuchen lässt, uns selbst zu sichern, indem wir die Welt, in der wir sind, stabilisieren. Wir verlangen nach einer Welt der verlässlichen, selbst-existierenden Dinge, die in objektiver Zeit und objektivem Raum fixierbar sind und die solcherart wechselwirken, dass wir lernen können sie zu manipulieren. Sobald eine vorhersagbare Welt uns unwillkürlich geworden ist, können wir uns darauf konzentrieren, unsere Ziele innerhalb dieser Welt zu erreichen. Doch gibt es noch einen anderen Grund für dieses „Vergessen“, wenn nämlich das Gefühl eines Selbst in dieser Welt gleichzeitig mit dieser Welt konstituiert wird: in diesem Fall kann jener Vorgang der Konstituierung für das Selbst-Bewusstsein nicht zugänglich sein, weil er zugleich die Grundlage des Selbst-Bewusstseins ist. Wenn ich also die Tatsache verdränge, dass meine objektive Welt konstituiert ist, dann verdränge ich damit auch die Tatsache, dass Ich konstituiert bin.
Die Folgerung daraus in Hinblick auf Projektion und Übertragung ist, dass unbewusste Phänomene nicht an irgendeinem unbestimmten mentalen Ort innerhalb von mir gesucht werden müssen, sondern dass sie in den Manifestationen meiner Welt gefunden werden können. Wenn ich also mein Unterbewusstsein finden will, sollte ich mir die Strukturen meiner Welt anschauen, und wenn wir unser kollektives Unterbewusstsein lokalisieren wollen, dann müssen wir die miteinander geteilten Strukturen unserer sozialen Welt betrachten.
Was wirklich [bei der Übertragung] geschieht ist nicht, dass der neurotische Patient Gefühle, die er für seine Mutter oder seinen Vater hatte, nun auf Ehefrau oder Therapeuten „überträgt“. Vielmehr ist der neurotische Mensch jemand, der sich in bestimmten Gebieten niemals über die eingeschränkten und begrenzten Formen der Erfahrung, wie sie typisch für das Kleinkind sind, hinausentwickelt hat. Also nimmt er in späteren Jahren die Ehefrau oder den Therapeuten durch die gleiche begrenzte und verzerrte „Brille“ wahr, mit der er Vater oder Mutter wahrnahm. Das Problem kann in Begriffen der Wahrnehmung und Beziehung zur Welt verstanden werden (May,1983, S. 154).
Jedoch bedeutet dies nicht, dass die Entwicklung von weniger eingeschränkten Formen der Erfahrung, wie sie typisch für die meisten Erwachsenen sind, eine zufriedenstellende Lösung ist. Die „Pathologie der Normalität“ (Fromm) oder die „Psychopathologie des Durchschnitts“ (Maslow) sind insofern keine Antwort, als das Kind ja Vater des Mannes ist und wir „durch das Alter vergrößerte“ Kinder bleiben. Der Unterschied ist, dass die Welt des Kleinkindes bestimmt ist durch die Welt seiner Eltern, aber wenn wir aufwachsen investieren wir aus unserem Bedürfnis nach Sicherheit heraus in größere soziale Strukturen, die den Wettbewerb um sozial anerkannte Sicherheiten und Statussymbole betonen: Reichtum, Preise, Macht, und so weiter.
Jung beschrieb Projektion als einen Vorgang, der zu einer traumgleichen Erfahrung der Welt führt:
Die Projektion hat die Wirkung, das Subjekt von seiner Umwelt zu isolieren, da nun statt einer realen Beziehung zu ihr nur noch eine illusorische Beziehung besteht. Projektionen verändern die Welt in eine Replikation des eigenen unbekannten Gesichts. In letzter Konsequenz führen sie somit zu einem auto-erotischen oder autistischen Zustand, in dem man sich eine Welt erträumt, deren Realität für immer unerreichbar bleibt (Jung, 1958, S. 8).
Jung bemerkte dazu auch noch, dass Menschen im Prozess der Individuation ihre Projektionen in sich selbst zurücknehmen.
[Für ein Beispiel, wie unser sozial anerkanntes und scheinbar objektives Zeit-Schema dekonstruiert werden kann zu einem ewigen Jetzt, siehe Loy, D., „Whats Wrong with Being and Time: A Buddhist Critique of Heidegger“, Time and Society (1992), vol. 1 no. 2.]
Um die Prinzipien besser zu verstehen, die bei einer solchen De-Projektion von Bedeutung sind, können wir vom fünften Teil von Spinozas Ethik (1677/1982) Nutzen ziehen. Hier diskutiert Spinoza unter der Überschrift „Von der Macht des Intellekts oder Von der Menschlichen Freiheit“, wie die Freiheit des Menschen realisiert werden kann. Hier ist seine dritte These: „Eine Emotion, die eine Leidenschaft ist, hört auf eine Leidenschaft zu sein, sobald wir eine klare und deutliche Vorstellung von ihr gewinnen.“ Leiden wir passiv darunter, wie unser Geist arbeitet oder sind wir „selbst-bestimmt“, weil wir verstehen wie er funktioniert? These zwei macht es noch deutlicher, dass dies in psychotherapeutischer Sprechweise der Unterschied ist zwischen einer unbewussten Übertragung / Projektion und dem Bewusstsein dessen, was wir uns selbst antun: „Wenn wir eine Störung des Geistes oder eine Emotion von dem Gedanken einer externen Ursache entfernen und sie mit anderen Gedanken verbinden, dann werden Liebe oder Hass gegen die externe Ursache, ebenso wie die Schwankungen des Geistes, die aus jenen Emotionen entstehen, beseitigt.“
Früher in seiner Ethik definiert Spinoza Liebe und Hass als Freude und Schmerz, die jeweils von der Idee einer externen Ursache begleitet sind. Auf ähnliche Weise kann Angst als „Angst, begleitet von der Idee einer externen Ursache“ definiert werden und Schuld als „Angst, begleitet von der Idee einer internen Ursache (d.h. aus sich selbst)“. Die Lösungen sind jeweils ähnlich: die Aufhebung der Assoziation zwischen der Emotion und ihrer angenommenen externen (oder im Fall von Schuld: introjizierten) Ursache. Gerade dies hatte ich ja weiter oben empfohlenbewusst, um rein ontologische Schuld und Angst zu erfahren, unbehindert von jeglicher Projektion oder Introjektion.
Wenn mich etwas an einer Person besonders stört, besteht der psychotherapeutische Ansatz darin, dies als eine Gelegenheit zu benutzen, etwas über mich selbst zu lernen, indem ich untersuche, warum mich dies berührt. Spinoza zeigt auch auf, dass wenn ich psychologisch leide, es ja meine eigenen Wege des Denkens sind, verfremdet und projiziert, die mich in die Klemme gebracht haben. Versuche, mich symbolisch selbst zu real-isieren, bedeuten, dass ich Macht über mich an solche Personen und Situationen abgebe, die jene symbolische Realität bewilligen oder verweigern können, von der ich hoffe, sie werde meinen Mangel füllen.
Spinoza glaubt ebenso wie der Buddhismus daran, dass die wahre Freiheit verwirklicht werden kann, indem wir uns unserer verdrängten und dann projizierten mentalen Vorgänge bewusstwerden. Wenn ich z.B. von bestimmten Philosophen anerkannt werden will, die ich als bedeutend ansehe (meist weil Andere sie als bedeutsam ansehen), dann wird sich dies selbstverständlich auf das Wesen meiner Welt auswirken und auf die Weise, wie ich mich gezwungen fühle, in dieser meiner Welt zu handeln. Spinoza zeigt mir nun, wie ich realisieren kann, dass die Ansichten dieser Philosophen keine Macht über den Zustand meines Geistes haben - dass ja stattdessen ich diesen Personen Macht über mich gebe durch die Weise, wie ich über den Zustand ihres Geistes denke. Indem ich zu einer „klaren und deutlichen Idee“ meines Wunsches nach ihrer Zustimmung gelange - dadurch, dass ich mir bewusst werde, anstatt dass ich nur motiviert werde - kann ich meinen Wunsch unterscheiden von meiner Vorstellung dieser Personen („der Gedanke einer externen Ursache“) und stattdessen die Verbindungen zwischen diesem Wunsch und anderen Ideen von mir bemerken, wie etwa mein Wunsch, ein berühmter Denker zu werden („verbinde es mit anderen Gedanken“). Auf diese Weise kann ich mich von den „Schwankungen des Geistes“ befreien, die aus meiner Angst der Bewertung durch Andere und meinem Bedürfnis, von ihnen wertgeschätzt („geliebt“) zu werden, entstehen. Dies heißt nicht, dass ich indifferent den Meinungen Anderer gegenüber werden soll, aber es erlaubt mir doch, in einer mehr selbstbestimmten Weise zu antworten, eher informiert von anderen Ansichten als beeinflusst.
Duhkha im Buddhismus
Einem Mönch, dessen Geist solcher Weise befreit ist, können noch nicht einmal die Götter folgen und ihn auffinden … Ja, selbst in diesem jetzigen Leben, ihr Mönche, so sage ich, kann ein befreites Wesen nicht wirklich erkannt werden. Und obwohl ich dies so sage und lehre, klagen mich einige Asketen und Brahmanen falsch und grundlos an, indem sie behaupten, der Asket Gotama ist ein Nihilist ist und lehrt die Vernichtung, Zerstörung und Nicht-Existenz des lebendigen Wesens. Dies bin ich nicht und solche Lehre bestätige ich nicht. Sowohl früher wie auch jetzt lehre ich Duhkha und das Ende von Duhkha (Sakyamuni Buddha, Majjhima Nikaya 22).
Ich kenne keine genaue buddhistische Entsprechung für das psychoanalytische Konzept der Verdrängung und der Rückkehr des Verdrängten als Symptom. Jedoch haben wir schon festgestellt, dass der Buddhismus einen Ausdruck hat, der mit dem Mangel-Gefühl, so wie ich dies oben verwendet habe, korrespondiert - und nicht zufällig ist dies wohl das wichtigste Konzept von allen: Duhkha. Der Buddha fasste mehrfach seine Lehren in vier Wahrheiten zusammen: Duhkha, die Ursache von Duhkha, das Ende von Duhkha und den Weg zur Beendigung von Duhkha. Was dies zu einer Entsprechung von Mangel macht, ist, dass der Buddhismus einen grundlegenden Zusammenhang zwischen unserem Duhkha und unserem täuschenden Selbst-Gefühl sieht. Um Duhkha zu beenden, muss das Selbst-Gefühl dekonstruiert werden.
Duhkha ist ein Begriff aus dem Sanskrit, der Leiden, Schmerz, Beschwernis, Frustration, usw. bedeutet. Die erste Wahrheit definiert den Homo Sapiens als das unbefriedigte Tier. Solange wir die letztendliche Quelle unseres Duhkha nicht konfrontieren, solange wird jede Verbesserung eines Lebensaspektes nur die Betonung von Duhkha zu einem anderen Aspekt hin verschieben: z.B. von physischem Schmerz hin zu psychischem Stress. Dies ist, genau wie bei der Angst im psychoanalytischen Verständnis, deshalb so, weil Duhkha nicht etwas ist, was wir haben, sondern etwas, das wir sind.
Die frühe Kommentar-Tradition unterscheidet drei Arten von Duhkha. In der ersten Art von Duhkha ist all das enthalten, was wir normalerweise als Leiden und Beschwernis ansehen, also Geburtstrauma, Krankheit, Kummer, körperlicher Verfall, Todesangst, verbunden sein mit dem, was man nicht mag, getrennt sein von dem, was man liebt, usw. Wenn wir für einen Augenblick von solchen Leiden frei sind, dann können wir über die zweite Art von Duhkha nachdenken, die durch Anitya, die Unbeständigkeit, verursacht wird. „So ist die Situation im Leben, dass niemand ohne die Erwartung einer Veränderung glücklich ist: die Veränderung selbst ist nichts, denn wenn wir sie erreicht haben, so ist unser nächster Wunsch eine erneute Veränderung“ (Dr. Johnson). So lange, wie es den Mangel gibt, ist das wirkliche Leben immer anderswo. In der modernen Zeit hat sich dieses Problem verschlimmert:
Auf der einen Seite ist die moderne Identität offen, kurzlebig und einer andauernden Veränderung unterworfen, andererseits stellt ein subjektiver Identitätsbereich den wesentlichen Halt des Individuums in der Realität dar. So wird ein sich ständig änderndes Etwas als das ens realissimum angenommen. Daher sollte es nicht überraschen, dass der moderne Mensch von einer permanenten Identitätskrise belastet wird, ein Zustand, der eine beachtliche Nervosität fördert.
… Die letztliche Folge aus all diesem kann sehr einfach ausgedrückt werden (obwohl die Einfachheit trügerisch ist): der moderne Mensch hat einen sich vertiefenden Zustand der „Heimatlosigkeit“ erlitten. Dieser unstete Charakter seiner Erfahrung mit der Gesellschaft und sich selbst entspricht dem, was man einen metaphysischen Verlust der „Heimat“ nennen könnte. Es versteht sich von selbst, dass dieser Zustand psychologisch schwer zu ertragen ist (Berger, Berger & Kellner, 1973, S. 74, 77).
Der besondere Beitrag des Buddhismus ist, wie er diese ersten beiden Arten von Duhkha-Unbehagen und Unbeständigkeit - mit der Struktur des Selbst-Gefühls in Beziehung setzt: die dritte Art von Duhkha entsteht aufgrund der konditionierten Zustände, der physischen und mentalen Faktoren, deren Wechselwirkung das Ich-Selbst konstituiert. Samadhi, die meditative Versenkung, ermöglicht es uns, unser Mangel-Gefühl zu beenden, indem wir die Fähigkeit kultivieren, uns selbst zu vergessen, wodurch das Selbst-Gefühl sich selbst loslässt. Der Rest dieses Aufsatzes diskutiert diese buddhistische DekonstrSchlussteiluktion. Der folgende Abschnitt präsentiert die ontologische und epistemologische Dekonstruktion des Selbst nach der buddhistischen Doktrin. Der Schlussteil betrachtet diese Dekonstruktion mehr von der phänomenologischen Seite, also aus der Sicht der buddhistischen Praxis, um zu verstehen, wie diese das Problem unseres Mangels löst.
Buddhistische Dekonstruktion des Selbst
Der Buddhismus dekonstruiert das Selbst-Gefühl auf zweierlei Weise: synchron in die fünf Skandhas, wörtlich Haufen oder Gruppen, und diachron in das Pratitya-Samutpada, das abhängige Entstehen. Diese Lehren erklären, wie die Illusion eines Selbst entsteht und funktioniert und implizieren auch, wie diese Illusion beendet werden kann.
Die fünf Skandhas sind die physischen und mentalen Faktoren, welche die psychophysische Persönlichkeit bilden. Sie werden normalerweise übersetzt als: Form, einschließlich des materiellen Körpers mit seinen Sinnesorganen; Gefühle und Empfindungen; Wahrnehmungen; mentale Formationen (oder Willens-Tendenzen), einschließlich Gewohnheiten und Veranlagungen; Bewusstsein, hier verstanden als das Sechs-Sinnes-Bewusstsein (einschließlich des mentalen Bewusstseins der mentalen Ereignisse). Diese fünf Skandhas werden auch „die fünf Gruppen des Ergreifens“ genannt. Alle mit dem Selbst-Gefühl zusammenhängenden Erfahrungen können mittels dieser fünf „Gruppen“ ohne irgendwelche anderen Bezüge analysiert werden und über oder jenseits der Funktionsweisen der fünf Skandhas gibt es kein inhärentes Selbst und keine transzendente Seele. Der Buddha betonte, dass diese fünf Skandhas nicht das Selbst konstituieren, sondern dass ihre Wechselwirkung die Illusion eines Selbst erzeugt. Die empfohlene Einstellung ist daher, jedes Skandha „der Wirklichkeit gemäß mit rechter Weisheit folgendermaßen zu betrachten: ‘Dies ist nicht meins, dies bin nicht ich, dies ist nicht mein Selbst’“. Als Folge davon „wendet sich der wohlgeschulte edle Jünger, der dies versteht, von den Skandhas ab, wird frei von allen Leidenschaften und wird dadurch vollkommen befreit“ (Anatta-Lakkhana Sutra, „Die Merkmale des Nicht-Ich“, Samyutta Nikaya 22.59).
Jedoch trat die Skandha-Dekonstruktion des Selbst gegenüber der Lehre des Pratitya-Samutpada (des abhängigen Entstehens) in den Hintergrund, und wurde sogar mit unter diese wichtigste Lehre des Buddhismus zusammengefasst. Der Buddha betonte, dass jemand der Pratitya-Samutpada versteht, seine Lehren versteht und umgekehrt. Das abhängige Entstehen erklärt unsere Erfahrung durch die Lokalisierung aller Phänomene innerhalb einer Menge von zwölf Faktoren, von denen jeder Faktor durch alle anderen Faktoren bedingt ist und wiederum selbst alle anderen bedingt. Die zwölf Verbindungen dieser Kette (eine spätere scholastische Konstruktion, welche kürzere Ketten integriert, die der Buddha zu verschiedenen Gelegenheiten ausführte) werden traditionellerweise wie folgt verstanden. [Für eine wissenschaftliche Untersuchung von Pratitya-Samutpada in der früh-buddhistischen Literatur siehe: Govind Chandra Pande, Studies in the Origin of Buddhism (Dehli: Motilal Banarsidas, 2nd ed. 1983), S. 407-442. „Wenn wir einmal von der zentralen Idee absehen, … , so ist die Formulierung durch Anlagerungen, Zusammenfügungen und Analysen gewachsen. In ihrer voll entwickelten Form ist sie deshalb von einer Aura der Vagheit umgeben, und in Details tauchen sogar Innkonsistenzen auf“ (S. 441).]
Die Voraussetzung für den ganzen Prozeß ist (1) Unwissenheit oder Unachtsamkeit, weil wir, in unserem normalen Eifer unsere Wünsche zu befriedigen, etwas in der Erfahrung übersehen. Aufgrund dieser Unwissenheit wirken die anderen Faktoren, einschließlich der (2) Willens-Tendenzen (der vierte der Skandhas) aus dem vorherigen Leben einer Person, welche den physischen Tod überlebt haben und so eine neue Geburt verursachen. Der originale Sanskrit-Ausdruck Samskarah bezieht sich auf den Einfluss, den vorhergegangene mentale Aktivitäten auf unsere willentlichen Handlungen haben. Das Fortwirken dieser Willens-Tendenzen erklärt, wie Wiedergeburt ohne ein permanentes Selbst zustande kommt: der Samskarah überlebt den physischen Tod, um das neue (3) Bewusstsein zu beeinflussen, welches entsteht, wenn eine befruchtete Eizelle sich entwickelt. Die Empfängnis verursacht das Wachstum von (4) Körper-Geist, des Fötus, welcher (5) Sinnes-Organe entwickelt, die den (6) Kontakt zwischen dem jeweiligen Sinnes-Organ und seinem entsprechenden Sinnes-Objekt ermöglichen, was dann zum Entstehen von (7) Empfindungen führt und zum (8) Verlangen nach diesen Empfindungen. Verlangen verursacht (9) Ergreifen oder Anhaften ans Leben ganz allgemein. Dieses Anhaften und Festklammern wird traditionell in vier Typen unterteilt: sich klammern an Vergnügen, an Sichtweisen, an Moral-Regeln oder äußere Riten und an den Glauben an eine Seele oder ein Selbst. Diese Klassifikation ist bemerkenswert, weil sie jeden Wesensunterschied zwischen einem Ergreifen durch die physischen Sinne und dem rein mentalen Anhaften ignoriert; offensichtlich manifestiert sich die gleiche problematische Tendenz bei all diesen vier Typen des Anhaftens. Ergreifen führt zu (10) Werden, d.h. der Tendenz zu einer Wiedergeburt nach dem physischen Tod, und dies verursacht eine (11) weitere Geburt und darum (12) „Verfall und Tod, Trauer, Klagen, Schmerz, Kummer und Verzweiflung“. Und so geht der Kreislauf weiter.
Der erstgenannte Faktor, Unwissenheit, wird nicht verstanden als eine „erste Ursache“, die irgendwann in der Vergangenheit den ganzen Prozeß initiiert hat. Jeder der zwölf Faktoren bedingt alle anderen, und es gibt im Buddhismus keinerlei Referenz zu irgendeiner ursprünglichen Zeit vor diesem Kreislauf. Sogar (8) Verlangen, das die zweite Edle Wahrheit als die Ursache von Duhkha benennt, wird hier erklärt als bedingt durch (7) Empfindung, welche wiederum bedingt wird durch (6) Kontakt, und so weiter. Als Antwort auf das Problem, wie Wiedergeburt möglich ist ohne eine unsterbliche Seele oder ein Selbst, das wiedergeboren wird, erklärt man die Wiedergeburt als eine Reihe von unpersönlichen Prozessen, die auftreten, ohne dass irgendein Selbst diese Prozesse steuert oder sie erfährt. In einem Pali-Sutra fragt ein Mönch den Buddha, zu wem die Phänomene, die im Pratitya-Samutpada beschrieben werden, gehören und wem sie widerfahren. Der Buddha weist diese Frage als unzutreffend zurück; jeder Faktor bedingt einen anderen Faktor; das ist alles. Die karmischen Ergebnisse einer Handlung werden erfahren, ohne dass da jemand wäre, der das Karma erschuf oder dessen Früchte erfährt, obwohl es eine kausale Verbindung zwischen der Handlung und ihrem Ergebnis gibt.
Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied, und dies führt hin zur buddhistischen Lösung aus dem Leidenskreislauf. „Durch das vollständige Schwinden und Erlöschen dieser Unwissenheit [der erste Faktor], erlöscht auch der Samskarah [zweiter Faktor]“, dessen Erlöschen dann wiederum den dritten Faktor beeinflusst, und so weiter, bis alle zwölf Faktoren erloschen sind. „Auf solche Weise findet das Erlöschen dieser ganzen Leidensanhäufung statt.“ Diese Formulierung hat sowohl viele Buddhisten als auch westliche Kommentatoren dazu ermutigt, den Buddhismus als nihilistisch anzusehen, wiewohl Sakyamuni Buddha selbst das verneint hat, da eine solche Interpretation die Bedeutung der Tatsache missversteht, dass es da niemals ein auszulöschendes Selbst gegeben hat.
Diese Darstellung grundlegender Lehren mag wie eine Abschweifung von unserer früheren Diskussion des Mangels und der Rückkehr des Verdrängten erscheinen. Es ist daher notwendig, die Verbindung zwischen solchen theoretischen Konstrukten und der Praxis, die sie untermauern, im Gedächtnis zu behalten. Alle buddhistischen Lehren können als heuristisch angesehen werden, da sie alle auf den essentiellen Punkt zurückverweisen, nämlich unser Duhkha aufzulösen. Wir müssen verstehen, wie die Kette funktioniert, die zu Duhkha führt, um zu lernen, wie man es beenden kann. Wir müssen realisieren, wie gewisse, weitgehend automatische und unbewusste Wege uns selbst in der Welt sehen, sowohl unser Selbst-Gefühl aufrechterhalten, als auch die objektivierte Welt, in der wir uns befinden. Und wir müssen realisieren, dass alles, was auf solche Art konstruiert wurde, auch wieder dekonstruiert werden kann.
Von diesem Gesichtspunkt aus ist das wichtige Problem also nicht, ob die fünf Skandhas der einzige synchrone Weg sind um das Selbst-Gefühl zu analysieren, oder ob die buddhistischen Aussagen zu Karma und Wiedergeburt wahr sind, sondern bedeutsam ist die enge Verbindung zwischen Duhkha und dem Selbst-Gefühl. Unsere Diskussion dieser Verbindung ist jedoch noch nicht vollständig, da sich das buddhistische Verständnis von Pratitya-Samutpada mit der Entwicklung des Mahayana radikal verändert hat. Nagarjunas Interpretation des Pratitya-Samutpada begründete eine „Kopernikanische Revolution“ innerhalb des Buddhismus, und der locus classicus dieser Revolution findet sich in seinen Mulamadhyamikakarikas (im folgenden MMK, Candrakirti, 1979). Lassen Sie uns also betrachten, was der MMK über Sunyata und Nirvana sagt. [Für diese Arbeit wurde die Übersetzung von Mervyn Sprung herangezogen aus Lucid Exposition of the Middle Way (Boulder, CO: Prajna Press, 1979), Candrakirtis klassischer Kommentar zum MMK. Mervyn Sprung übersetzt Sunyata als „Abwesenheit eines Seins in den Dingen“.]
[Anmerkung des deutschen Übersetzers: im folgenden wird in eckigen Klammern unter dem Kürzel MMK-WB zusätzlich noch die neue und hervorragende deutsche MMK-Übertragung von B. Weber-Brosamer, D. M. Back, angeführt: Die Philosophie der Leere (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1997).]
Der erste Vers des MMK proklamiert dessen durchgängige Kritik an jeglichem Sein: „Zu keiner Zeit und an keinem Ort existieren irgendwelche Dinge, die aus sich selbst entstanden sind, aus anderem, aus beidem oder ohne Grund“ (MMK 1.1).
[„Nirgends und niemals findet man Dinge, entstanden aus sich, aus anderem, aus sich und anderem, ohne Grund“ (MMK-WB 1.1).]
Parallel zu der poststrukturalistischen Radikalisierung der strukturalistischen Behauptungen über Sprache zeigt Nagarjunas Argument einfach noch deutlicher die Implikationen des Pratitya-Samutpada. Abhängiges Entstehen ist keine Lehre über kausale Relationen zwischen Dingen, weil die gegenseitige Wechselwirkung dieser zwölf Faktoren bedeutet, dass sie keine wirklichen Dinge sind. Keines der zwölf Phänomene - welche allumfassend verstanden werden - ist selbst-existent, weil jedes mit den Einflüssen aller anderen behaftet ist. dass kein Selbst existiert, ist die Bedeutung von sunya und seines Substantivs Sunyata; diese beiden Worte sind bekannter Weise schwer zu übersetzen, werden aber normalerweise als „leer“ und „Leere“ wiedergegeben. Nagarjuna warnt umsichtig, dass Sunyata ein heuristisches Konzept ist: „Sunyata ist ein wegweisender und kein kognitiver Begriff und setzt die Alltagswelt voraus“ (MMK 24.18).
[„Das Entstehen in gegenseitiger Abhängigkeit, dies ist es was wir Leerheit nennen. Das ist (aber nur) ein abhängiger Begriff; gerade sie (die Leerheit) bildet den mittleren Weg“ (MMK-WB 24.18).]
Das Konzept der Leere setzt den Alltag voraus, weil es abhängig vom Begriff der Dinge ist, die es widerlegt, womit es sich selbst gleichzeitig auch widerlegt. Nagarjuna warnte, dass Sunyata wie eine Schlange sei, die am falschen Ende angefasst, tödlich sein kann: „Die geistigen Sieger haben erklärt, dass Sunyata die Erschöpfung aller Theorien und Sichtweisen ist; jene, für welche Sunyata selbst eine Theorie ist, haben sie für unheilbar erklärt“ (MMK 24.11).
[„Die falsch aufgefasste Leerheit richtet den, der von schwacher Einsicht ist, zugrunde - wie eine schlecht ergriffene Schlange oder falsch angewandte Magie“ (MMK-WB 24.11).]
Der Zweck von Sunyata ist, die Selbst-Existenz der Dinge zu dekonstruieren. Nagarjuna wendet sich an die wesentlichen philosophischen Theorien seiner Zeit, doch sein wirkliches Ziel ist jene unbewusste, automatisierte Metaphysik, getarnt als: die Welt in der wir leben. Wenn Philosophie lediglich die Hauptbeschäftigung der Akademiker wäre, könnte man sie ignorieren, aber wir haben in dieser Angelegenheit keine Wahl, weil wir alle Philosophen sind. Die fundamentalen Kategorien des Alltags sind für uns selbst-existente / selbst-daseiende Dinge, die entstehen, sich verändern und schließlich aufhören zu sein; um die Beziehungen zwischen diesen Dingen zu erklären, müssen auch die Kategorien von Raum, Zeit und Kausalität herangezogen werden. Das wichtigste und problematischste dieser angeblich selbst-existenten Dinge ist natürlich das Selbst: die buddhistische Sichtweise der gegenseitig voneinander abhängigen Faktoren ist somit diametral entgegengesetzt zu der kartesischen Ansicht eines autonomen, selbst-begründeten Bewusstseins. Und der Träger dieser Metaphysik des gesunden Menschenverstandes, welcher diese kreiert und aufrechterhält, ist die Sprache, die uns einen Satz Substantive (selbst-existente Dinge) präsentiert, die zeitliche und kausale Prädikate haben (entstehen, verändern und enden).
Kann unser Duhkha in Begriffen von Sunyata und Pratitya-Samutpada erklärt werden? Das Ich-Selbst ist irreführend, weil es, ebenso wie alles andere, eine temporäre Manifestation ist, die aus der gegenseitigen Abhängigkeit zwischen den zwölf Faktoren entsteht, sich aber dennoch getrennt fühlt von dieser Kette und vom Rest der Welt. Die grundlegende Schwierigkeit ist, dass insoweit wie ich mich getrennt fühle (d.h. als ein autonomes, selbst-existentes Bewusstsein), ich mich auch unbehaglich fühle, weil eine illusorische Wahrnehmung von Trennung unvermeidlich unsicher ist. Es ist die unvermeidliche Spur des Nichts in meinem „leeren“ (da nicht wirklich selbst-existenten) Selbst-Gefühl, die als Mangel-Gefühl erfahren wird. Als Reaktion konzentriert sich das Selbst-Gefühl darauf, zu versuchen sich auf die eine oder andere symbolische Weise selbst-existent zu machen. Die tragische Ironie ist, dass die Wege, auf denen wir versuchen dies zu tun, nicht erfolgreich sein können, weil ein Selbst-Gefühl niemals die Spur des Mangels vertreiben kann, die das Selbst-Gefühl ja insoweit konstituiert, als es illusorisch ist; wohingegen wir im wichtigsten Sinne schon selbst-existent sind, weil die unendliche Menge von unterschiedlichen Spuren, die jeden von uns konstituieren, das gesamten Universum ausmachen. „Die Selbst-Existenz eines Buddha ist die Selbst-Existenz dieses Kosmos. Der Buddha ist ohne eine selbst-existente Natur; der Kosmos ist ebenfalls ohne eine selbst-existente Natur“ (MMK 22.16).
[„Das Eigensein des Tathagata ist dasselbe wie das Eigensein dieser Welt der Lebenden; wie also der Tathagata ohne Eigensein ist, so ist auch diese Welt ohne Eigensein“ (MMK-WB 22.16).]
Was Nagarjuna hier über den Buddha sagt, ist gleichermaßen wahr für jeden von uns, und in der Tat für alles und jedes; mit dem einzigen Unterschied, dass ein Buddha dies versteht.
Doch wenn wir nun darum kämpfen ein Buddha zu werden, so missverstehen wir die Lehren des Buddha. Statt dessen ist jene Gelassenheit, die wir suchen, „das zur Ruhe kommen aller Arten und Weisen Dinge zu ergreifen, das Stillwerden der benannten Dinge“ (sarvopalambhopasamaprapancopasamah) (MMK 25.24).
[„die Beruhigung aller Wahrnehmung, die Beruhigung der Entfaltung“ (MMK-WB 25.24).]
Nagarjunas wichtigster Kommentator, Candrakirti, erklärt diesen Vers folgendermaßen: „das wirkliche zur Ruhe kommen, das Aufhören von Wahrnehmungen als Zeichen aller benannten Dinge, genau dies ist Nirvana… Wenn die sprachliche Aktivität endet, so sind die benannten Dinge in Ruhe; und das Ende der Funktion der diskursiven Gedanken ist die letztendliche Gelassenheit“ (Candrakirti, 1979, S. 262). Dabei besteht das Problem nicht nur darin, dass Sprache als ein Filter wirkt, der die Natur der Dinge verdeckt, sondern Namen werden eben benutzt, um Erscheinungen in jene selbst-existenten Dinge zu objektivieren, die wir als Bücher, Tische, Bäume, dich und mich wahrnehmen. Das heißt also, dass die objektive Welt der materiellen Dinge, die kausal in Raum und Zeit wechselwirken, durch und durch metaphysisch ist. Es ist diese Metaphysik, verborgen als die Realität des gesunden Menschenverstandes, die mich insoweit leiden lässt, wie ich mich als ein selbst-existentes Wesen in der Zeit verstehe, ein Wesen das aber dennoch sterben wird.
Es ist möglich, unser Duhkha zu beenden, weil das zur Ruhe kommen im Benennen von Wahrnehmungen als selbst-existenten Objekten die automatisierte Innen-Außen Dualität zwischen unserem Selbst-Gefühl und der „objektiven“ Alltags-Welt dekonstruieren kann. Da diese Welt ebenso verschiedenartig ist wie sie voller Spuren ist - wie der textuelle Diskurs, den Derrida analysiert [zu Derridas textueller Dekonstruktion siehe z.B. Positions (1981) und Margins of Philosophy (1982), beide bei University of Chicago Press] - so ist der buddhistische Ansatz, jene Differenzen und Verschiebungen zu nutzen, um die objektivierte Welt zu dekonstruieren, einschließlich unserer selbst, da wir Subjekte ja als erstes objektiviert werden. Wenn nur Spuren von Spuren existieren, was passiert dann, wenn wir mit unserem Versuch aufhören, diese schwer fassbaren Spuren in selbst-präsente Dinge einzusperren? „Wenn eine anhaftende Wahrnehmung anwesend ist (upadane), dann erschafft der Wahrnehmende das Sein. Wenn keine anhaftende Wahrnehmung anwesend ist, dann wird er befreit und es wird kein Sein geben“ (MMK 26.7).
[„Indem das Ergreifen existiert, entwickelt sich das Werden des Ergreifenden. Denn: Hätte man kein Ergreifen, wäre man befreit und es gäbe kein Werden mehr“ (MMK-WB 26.7).]
Dies erklärt also, wie die buddhistischen Lehren die Selbst-Existenz der Dinge dekonstruieren, aber es genügt noch nicht, um zu verstehen, wie damit nun unser Mangel-Gefühl dekonstruiert wird. Der letzte Abschnitt wird diese Dekonstruktion ansprechen, indem wir betrachten, wie der fundamentalste aller Dualismen aufgelöst werden kann - der Dualismus zwischen meinem unbegründeten Gefühl des Seins und dem dieses Gefühl bedrohenden Nichtseins oder Nichts.
Den Geist aufscheinen lassen
Inzwischen ist klar geworden, dass unsere problematischste Dualität aus buddhistischer Sichtweise nicht Leben/Tod ist, sondern Selbst/Nicht-Selbst. In psychologischer Sprache ausgedrückt bedeutet dies, dass unsere primäre Verdrängung nicht die Angst vor dem Tod ist - welche ja das gefürchtete Ereignis immer noch auf Distanz hält, indem sie es in die Zukunft projiziert - sondern das Selbst-Gefühl, das sein erahntes Nicht-Sein jetzt verdrängt; und dieser Prozess, so habe ich oben argumentiert, wird uns bewusst als ein Mangel-Gefühl, das unser Selbst-Gefühl überschattet. Diese spezielle Polarität beeinflusst große Teile unseres Denkens. Ein gutes Beispiel ist Paul Tillichs The Courage to Be (1952). Tillich zufolge ist die ontologische Angst die Angst vor unserem letztlichen Nicht-Sein, die Angst vor unserer Unfähigkeit unser eigenes Sein zu beschützen. Da Tillich glaubt, dass diese Angst nicht aufgelöst werden kann, ist seine theologische Lösung, dass wir durch die Kraft des Seins akzeptiert seien, was uns den Mut gibt, das Sein trotz der Bedrohung des Nichtseins zu bejahen. Gott ist „die Selbst-Bejahung des Seins, das sich gegen das Nichtsein durchsetzt“.
Vielleicht ist es ja beruhigend zu wissen, dass Gott nicht auf der Seite des Nicht-Seins steht - was wohl der Grund dafür ist, warum Nichtsein im Englischen nicht groß geschrieben wird - aber der buddhistische Ansatz ist ein anderer, so wie es der im siebten Jahrhundert in China lebende Ch’an-Meister Hsüan-chüeh von Yung-chia ausdrückte: „Sein ist nicht Sein. Nicht-Sein ist nicht Nicht-Sein. Verfehle diese Regel um Haaresbreite und du gehst tausend Meilen daneben“ (Aitken, unveröffentlicht). Solche konzeptuellen Paradoxien mögen für unser Leben nicht besonders relevant erscheinen, doch die Spekulationen der Theologen und Metaphysiker stellen nur die abstrakteste Version eines Spiels dar, das tatsächlich unseren Kern berührt, wenn sich nämlich die Grundhaftigkeit oder Grundlosigkeit dieses Kerns als die grundlegende Frage herausstellt. Wie bei der Materie und Antimaterie der Quantenphysik stellt sich Nicht-Sein (erfahren als Mangel) als der Schatten des Seins (Selbst) heraus. Beide entstehen zusammen, in Abhängigkeit voneinander, und somit sollten sie auch gemeinsam verschwinden können, indem sie ineinander zurück-kollabieren - was nicht das Nichts, das wir fürchten, zurücklassen kann (da dies ja einer der beiden Pole ist), aber was dann…?
Im Samyutta Nikaya (35.85) erklärt Sakyamuni, dass die Welt leer ist von einem Selbst und etwas zu einem Selbst gehörigen, … darum wird gesagt, die Welt ist leer. Was ist diese Leere? Er sagt, dass dies gerade die sechs Sinnesorgane Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper und Geist sind, dazu ihre sechs Sinnesobjekte und die sechs korrespondierenden Arten von Sinnesbewusstsein. Doch der Buddha beschreibt diese gleichen achtzehn indriyas auch als Alles: „Wer auch immer, ihr Mönche, sagen wollte: ‘Weist dies Alles zurück, ich will ein anderes Alles behaupten’ - es wäre von ihm doch nur ein bloßes Gerede. … Und warum ist das so? Weil es eben nicht möglich ist, so etwas zu finden“. Der Buddha formuliert dann eine Lehre zur Überwindung des Alles: „Das Auge muss aufgegeben werden, visuelle Objekte müssen aufgegeben werden, Augen-Bewusstsein muss aufgegeben werden, Augen-Kontakt muss aufgegeben werden. Und jene angenehmen, schmerzlichen oder neutralen Empfindungen, die beim Augen-Kontakt aufsteigen, auch sie müssen auch aufgegeben werden.“ Und so weiter mit allen anderen Sinnen (Samyutta Nikaya 35.23-26). Da der Buddha nun gerade gesagt hat, dass diese achtzehn indriyas alles umfassen, erscheint eine solche Lehre sonderbar: es gibt nichts anderes, was man werden könnte, nichts anderes, dem man sich zuwenden könnte. Die Lösung ist so offensichtlich, dass wir sie leicht übersehen können: es geht einfach darum, die sunya, die „leere“ Natur dieser Phänomene zu realisieren, ein Ansatz den das Mahayana fortentwickelt hat.
Ebenso wie in der Psychotherapie schließt auch die buddhistische Antwort auf die bipolare Dualität das Anerkennen der verleugneten Seite ein. Wenn es der Tod ist, wovor sich das Selbst-Gefühl fürchtet, so ist die Lösung, das Selbst-Gefühl sterben zu lassen. Wenn es das Nichts (no-thing-ness) ist, wovor ich Angst habe (d.h. die verdrängte Intuition, dass das „Ich“ nur ein Konstrukt ist, anstatt autonom und selbstexistent zu sein), so ist der beste Weg diese Furcht zu lösen, zu Nichts werden. Der im zwölften Jahrhundert in Japan lebende Zen-Meister Dogen fasst diesen Prozess wie folgt zusammen:
Den buddhistischen Weg zu studieren bedeutet das Selbst zu studieren. Das Selbst zu studieren bedeutet das Selbst zu vergessen. Das Selbst zu vergessen bedeutet durch alle Dinge erweckt zu werden. Wenn du durch alle Dinge erweckt wirst, fallen dein Körper und Geist weg, ebenso wie der Körper und Geist der anderen. Keine Spur der Realisation bleibt zurück und diese Spurlosigkeit setzt sich ohne Ende fort (Dogen, in Tanahashi, 1985, S. 70).
Indem wir uns selbst „vergessen“, verlieren wir unser Gefühl der Getrenntheit und erkennen, dass wir nichts anderes sind als die Welt. Meditation bedeutet zu erlernen, wie ich Nichts werde, indem ich lerne das Selbst-Gefühl zu vergessen, und das geschieht eben dann, wenn ich von meiner Meditations-Übung absorbiert werde. Wenn das Selbst-Gefühl ein Resultat des Versuchs des Bewußtseins ist, sich selbst zu reflektieren, um sich selbst zu ergreifen, dann ist eine solche Meditationspraxis tatsächlich sinnvoll als eine Übung der De-Reflektion. Das Bewußtsein verlernt den Versuch, sich selbst zu ergreifen, zu real-isieren und zu objektivieren. Erleuchtung im Sinne des Buddhismus tritt dann ein, wenn die gewöhnliche, automatische Reflexivität des Bewußtseins verstummt, was als ein Loslassen, ein aus der Existenz heraus und in die Leere fallen, erfahren wird. „Die Menschen fürchten sich davor, ihren Verstand zu vergessen, sie fürchten, in die Leere zu fallen, ohne dass irgendetwas ihren Fall aufhalten könnte. Sie wissen nicht, dass die Leere nicht wirklich leer ist, sondern das Reich des wirklichen Dharma“ (Huangpo, Blofeld, 1958, S. 41). Wenn ich nicht länger danach strebe mich selbst durch Dinge real zu machen, dann finde ich mich durch sie „erweckt“, sagt Dogen. Dieser Vorgang impliziert, dass das von uns gefürchtete Nichts nicht wirklich Nichts ist, sondern einfach die Perspektive eines Selbst-Gefühls, das Angst davor hat, seinen Halt an sich selbst zu verlieren. Aus der Sicht des Buddhismus führt das Loslassen meines Selbst und Verschmelzen mit diesem Nichts (no-thing-ness) zu etwas anderem: wenn das Bewusstsein mit dem Versuch aufhört, seinen eigenen Schwanz zu fangen, werde ich Nichts (no-thing) und entdecke das ich Alles bin - oder, genauer, dass ich Alles sein kann.
Ein Beispiel aus der Zen Meditation mag hier hilfreich sein. In der Zen-Linie, mit welcher ich vertraut bin, wird ein Anfänger-Koan, wie Joshus Mu, mehr oder weniger wie ein Mantra behandelt. Indem man all seine mentale Energie in das „muuu …“ gibt (im Geist während des Ausatmens wiederholt), wird das Selbst-Gefühl durch das Loslassen der mentalen Prozesse, die es aufrechterhalten, unterminiert. Zu Beginn einer solchen Praxis versucht man sich auf das „muuu …“ zu konzentrieren, wird aber durch auftauchende andere Gedanken, Gefühle, Erinnerungen, Wünsche, usw., abgelenkt. Ein späteres, fokussierteres Stadium ist, wenn man sich auf das „muuu …“ konzentrieren kann, ohne es zu verlieren: „muuu …“ hält andere Gedanken, usw., effektiv fern. Das Stadium, „in dem Innen und Außen natürlich verschmelzen“, tritt dann auf, wenn es nicht mehr die Empfindung eines „Ich“ gibt, das einen objektiven Ton wiederholt; es gibt dann nur noch „muuu ….“ Dieses Stadium wird manchmal so beschrieben, dass „muuu …“ eben „muuu …“ macht: es ist „muuu …“ das sitzt, geht, isst, und so weiter.
Manchmal führt diese Praxis zu einem geistigen Zustand, der beschrieben worden ist als ein Hängen über einem Abgrund. „Mit Ausnahme gelegentlicher Gefühle der Unruhe und Verzweiflung, ist das wie der Tod selbst“ (Hakuin, in Suzuki, 1956, S. 148). Die Lösung ist es, sich selbst vollständig in das „muuu …“ hineinzuwerfen:
An der Ecke des Kliffs lass tapfer los. Entschlossen und mutig wirf dich selbst in den Abgrund. Nur nach dem Tod wirst du wieder zum Leben erwachen! (Po-shan, in Chang, 1959).
An diesem Punkt kann der Lehrer helfen, indem er den letzten Faden durchschneidet: eine unerwartete Handlung, wie ein Schlag oder ein Schrei oder sogar einige wenige leise Worte können den Schüler aufschrecken, so dass er loslässt. „Plötzlich findet er seinen Geist und Körper aus der Existenz herausgefallen, zusammen mit dem Koan. Dies ist bekannt als ‘deinen Halt loslassen’“ (Hakuin, in Suzuki, 1956, S. 148).
[Mehr zu diesem Prozess siehe Yasutani-Roshis „Kommentar zum Koan Mu“ in P. Kapleau, ed., The Three Pillars of Zen (Tokyo:Weatherhill, 1966), 71-82.]
Eine klassische Zen-Geschichte erzählt, wie ein Schüler durch den Klang eines an einen Bambus schlagenden Kiesels erleuchtet wurde. Wenn die Praxis reif ist, kann der Schock eines unerwarteten Sinneseindrucks helfen, zum innersten Kern des eigenen illusorischen Seins-Gefühls durchzubrechen - das heißt, zu einer nondualen Erfahrung.
Ist dies Sein oder Nichts? Grundlosigkeit oder Grundhaftigkeit? Wenn jedes Glied des Pratitya-Samutpada durch alle anderen bedingt ist, dann bedeutet vollständig grundlos zu werden auch vollständig grundhaft zu werden, nicht in irgendeinem Punkt, sondern in dem ganzen Netzwerk der Wechselwirkungen, welche die Welt konstituieren. Die letztliche Ironie meines Kampfes um einen festen Grund für mich ist, dass dieser Kampf keinen Erfolg haben kann, weil ich schon in der Totalität begründet bin. Der Buddhismus kommt zu dem Ergebnis, dass ich grundlos und unbegründbar insoweit bin, als ich mich fälschlicherweise von der Welt getrennt fühle; und ich war schon immer vollständig begründet insoweit, als die Welt ich ist und ich die Welt bin. Mit dieser Zusammenfaltung wird das Nichts (no-thing) in meinem Innersten von einem Mangel-Gefühl in eine Gelassenheit transformiert, die deshalb unerschütterlich ist, weil nichts da ist, was erschüttert werden kann. „Wenn weder Sein noch Nicht-Sein dem Geist dargeboten werden, dann wird, mangels jeglicher anderen Möglichkeit, das was ohne Stütze ist, ruhig werden“ (Santideva).
[Bodhicaryavatara 9.35, s.a. MMK 7.16: „Alles was aufgrund des abhängigen Entstehens existiert, ist letztlich Stille.“]
Wie löst das Gesagte das Problem des Verlangens, unser hin und her zwischen Frustration und Langeweile? Ein Bewußtsein, das versucht sich selbst zu begründen, indem es sich auf irgendetwas fixiert, verurteilt sich selbst zu fortwährender Unzufriedenheit, da die Unbeständigkeit aller Dinge eben bedeutet, dass kein fester Halt gefunden werden kann. Aber da es unser Mangel ist, der uns dazu veranlasst, einen solchen festen Halt zu suchen, erlaubt das Ende des Mangels einen Wechsel in der Perspektive. Die Lösung besteht in einem anderen Weg das Problem zu erfahren: in Hegelschen Worten ist dies die „frei-bewegliche Variable“, die immer irgendeine endliche Festlegung hat, aber nicht an eine bestimmte gebunden ist. Die schlechte Unendlichkeit des Mangels verwandelt sich in die gute Unendlichkeit einer Variablen, die keiner Sache bedarf. In buddhistischer Sprache transformiert dies die Entfremdung eines reflexiven Selbst-Gefühls, das ständig versucht sich selbst zu fixieren, in der Freiheit eines „leeren“ Geistes, der alles werden kann, weil er nicht irgendetwas werden muss.
Das Astasahasrika Prajnaparamita Sutra beginnt mit einer Beschreibung dieser guten Unendlichkeit:
Wir können keine Weisheit auffinden, keine höchste Vollkommenheit, Keinen Bodhisattva und auch keine Vorstellung von Erleuchtung. Wenn er dies erfährt und darüber nicht verwirrt oder ängstlich wird, So geht ein Bodhisattva den Weg in der Weisheit des Tathagata. Nirgendwo in Form, Empfindung, Wahrnehmung, Willen und Bewusstsein [den fünf Skandhas] finden die Bodhisattvas einen Platz zum Niederlassen. Sie wandern heimatlos, Dharmas binden sie nicht, noch ergreifen sie diese (Conze, 1973, 1:5-7, S.9).
Für den Buddhismus ist das Problem des Begehrens gelöst, wenn kein Verlangen nach Sein mich mehr dazu zwingt, irgendetwas zu ergreifen und zu versuchen mich darin niederzulassen, wenn ich also frei bin es zu werden. Die buddhistische Lösung des Problems des Lebens ist daher sehr einfach: das „bong!“ einer Tempelglocke, das „tock!“ eines gegen einen Bambus aufschlagenden Kiesels, die Blüten an einem Baum im Frühling, um einige Zen-Beispiele zu nennen. Natürlich haben wir die ganze Zeit versucht zu einem Objekt zu werden, doch auf eine uns selbst schadende Weise, zwanghaft nach unseren eigenen Objektivierungen greifend, um uns selbst zu stabilisieren. Aber ich kann nicht zu etwas werden, indem ich danach greife. Das verstärkt nur das illusionäre Gefühl der Getrenntheit zwischen dem Ergriffenen und dem Ergreifenden. Gemäß dem Buddhismus ist der einzige Weg, wie ich zu einem Phänomen werden kann, zu realisieren, dass ich es schon immer war. Wenn von dem Objekt überhaupt nichts benötigt wird, um meinen Mangel zu füllen, dann kann dieses Objekt einfach das sein, was es ist - die nachhallende Tempelglocke, etc. Und dies ist nun nicht länger frustrierend, weil es jetzt in meinem Inneren keinen Mangel mehr gibt, den ich als einen Mangel meiner Welt wahrnehmen muss.
Wenn ich aber das Objekt bin, ist es sinnlos, dies als ein Objekt zu verstehen. Wenn es kein Selbst-Gefühl im Innern gibt, dann kann es auch kein Außen geben. Im „Sokushinzebutsu“ Kapitel des Shobogenzo zitiert Dogen den chinesischen Ch’an-Meister Yang-Shan: der Geist ist „Berge, Flüsse, Erde, Sonne, Mond und Sterne“. Dieser Geist ist nicht irgendein transzendentes Absolutes. Er ist nichts anderes als dein Geist und mein Geist, wenn er realisiert wird als eine frei-bewegliche Variable, die an keine bestimmte Festlegung gebunden ist. Solch ein Geist ist ab-solut in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes, d.h. unkonditioniert. Meditations-Übungen dekonditionieren den Geist von seiner Tendenz, sich selbst durch das Kreisen in vertrauten Bahnen abzusichern, und dadurch erwächst dem Geist die Freiheit alles zu werden. Die meist zitierte Zeile des bekanntesten aller Mahayana Sutras, des Diamant-Sutra, faßt all dies in einem einzigen Satz zusammen: „Laß deinen Geist aufscheinen ohne ihn irgendwo festzumachen.“
Zusammenfassung
Wir haben gesehen, wie der Buddhismus die widerstrebenden Schlussfolgerungen der modernen Psychologie voraus genommen hat: Schuld und Angst ergeben sich nicht zufällig, sondern sind dem Ego immanent. Meiner Interpretation des Buddhismus zufolge entsteht unsere Unzufriedenheit mit dem Leben aufgrund einer Verdrängung, die noch unmittelbarer ist, als die Todesangst: dem Verdacht, dass „Ich“ nicht wirklich bin. Das Selbst-Gefühl ist nicht selbstexistent, sondern eine mentale Konstruktion, die ihre eigene Grundlosigkeit als einen Mangel erfährt. Dies Mangel-Gefühl ist konsistent zu dem, was die Psychotherapie über ontologische Schuld und grundlegende Angst herausgefunden hat. Normalerweise werden wir mit diesem Mangel fertig, indem wir ihn auf verschiedene Weisen objektivieren und dann versuchen, ihn durch Projekte zu lösen - doch diese können nicht erfolgreich sein, weil sie nicht das fundamentale Problem ansprechen.
Also ist unser allerproblematischster Dualismus nicht das Lebens, das den Tod fürchtet, sondern ein fragiles Selbst-Gefühl, das seine eigene Grundlosigkeit fürchtet. Indem ich diese Grundlosigkeit akzeptiere und mich ihr ergebe, kann ich entdecken, dass ich schon immer begründet war, nicht als ein selbst-begrenztes Wesen, sondern als eine Manifestation eines Netzes von Beziehungen, die alles umfassen. Dies löst das Problem des Verlangens durch dessen Transformation. Solange wir durch den Mangel angetrieben sind, wird jedes Verlangen zu einem Schwierigkeiten produzierenden Zusatz, der versucht ein Fass ohne Boden aufzufüllen. Ohne Mangel gewährt die Gelassenheit unseres Nichts (no-thing-ness), d.h. die Abwesenheit irgendeines fixierten Wesens, die Freiheit Alles zu werden.
Anmerkung
David Loy hat inzwischen weiter über das Thema dieses Artikels gearbeitet und die Ergebnisse in dem folgenden Buch veröffentlicht: Lack and Transcendence: The Problem of Death and Life in Psychotherapy, Existentialism, and Buddhism
Literaturangabe
- Aitken, R. (1975). unveröffentlichte Übersetzung von Yung-chias Cheng-tao Ke, Lied der Erleuchtung.
- Becker, E. (1973). The denial of death. New York: Free Press.
- Becker, E. (1975). Escape from evil. New York: Free Press.
- Berger, P., Berger, B. & Kellner, H. (1973).The homeless mind. New York: Penguin.
- Bloefeld, J. (übers.) (1958). The Zen teaching of Huang Po. London: Buddhist Society.
- Brown, N. O. (1961). Life against death: The psychoanalytic meaning of history. New York: Vintage.
- Candrakirti (1979). Lucid exposition of the middle way. M. Sprung (übers.). Boulder: CO: Prajna Press.
- Chang, G. C. C. (übers. u. ed.) (1959). Discourses of Master Po Shan. The Practice of Zen. New York: Harper & Row.
- Conze, E. (übers. u. ed.). The perfection of wisdom in eight thousand lines and its verse summary. Bolinas: Four Seasons Foundation.
- Freud, S. (1916). Some character types met in psychoanalytic work. Standard Edition. London: Hogarth Press, 1957. 14:311-333. [dt.: Einige Charaktertypen aus der psychoanalytischen Arbeit.]
- Freud, S. (1923/1989). The ego and the id. J. Riviere (übers.). New York: Norton.
- Freud, S. (1926/1989). Inhibitions, symptoms and anxiety. A. Strachey (übers.). New York: Norton.
- Freud, S. (1930/1989). Civilization and ist discontents. J. Strachey (übers. u. ed.). New York: Norton. [dt.: (1929) Das Unbehagen in der Kultur.]
- Jung, C. (1958). Psyche and Symbol. V. S. deLaszlo (ed.). New York: Anchor.
- Kierkegaard, S. (1957). The concept of anxiety. W. Lowrie (übers.). Princeton: Princeton University Press.
- May, R. (1977). The meaning of anxiety. New York: Norton.
- May, R. (1983). The discovery of being. New York: Norton.
- MMK. Siehe Candrakirti (1979).
- Neumann, E. (1973). The origins and history of consciousness. Princeton: Princeton University Press.
- Nietzsche, F. (1956). The birth of tragedy and the genealogy of morals. F. Golffing (übers.). New York: Doubleday Anchor.
- Nietzsche, F. (1968a). Thus spake Zarathustra. W. Kaufmann & R. J. Hollingdale (übers). New York: Vintage.
- Nietzsche, F. (1968b). The will to power. W. Kaufmann & R. J. Hollingdale (übers). New York: Vintage.
- Pande, G. C. (1983). Studies in the origins of Buddhism. 2. Aufl., Dehli: Motilal Banarsidas.
- Rank, O. (1958). Beyond psychology. New York: Dover.
- Schmideberg, M. (1956). Multiple origins and functions of guilt. Psychiatric Quarterly, 30.
- Spinoza, B. (1677/1982). Ethics. S. Shirley (übers.). Indianapolis, IN: Hackett.
- Suzuki, D. T. (1956). Zen Buddhism. New York: Anchor.
- Tanahashi, K. (ed.) (1985). Moon in a dewdrop: Writings of Zen master Dogen. San Francisco: North Point Press.
- Tillich, P. (1952). The courage to be. New Haven, CN: Yale University Press. [dt.: (1953). Der Mut zum Sein.]
- Vasubandhu (1964). Trimsikavijnaptikarika. In E. Conze (übers.), Buddhist texts through the ages. New Yorker: Harper.
- Yalom, D. (1980). Existential psychotherapy. New York: Basic Books.
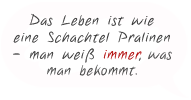

Was fühlst du?